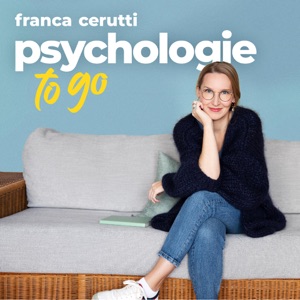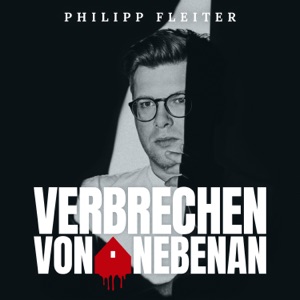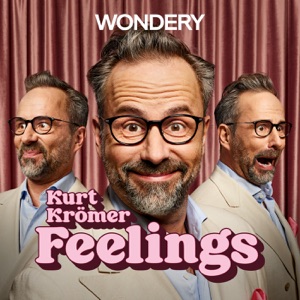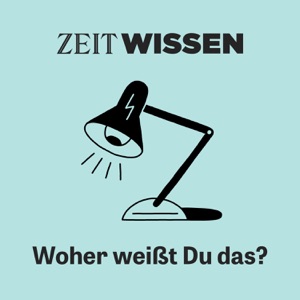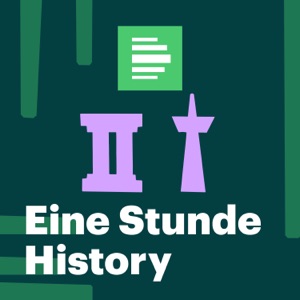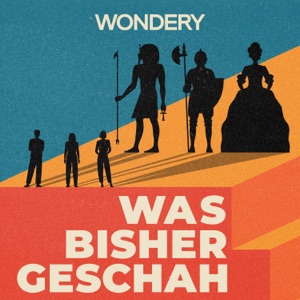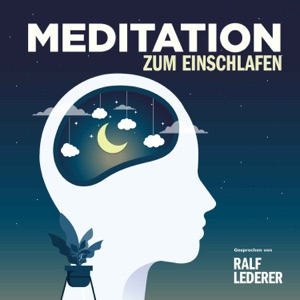Podcasts by Category

- 1123 - Da war doch was: Diskussionen über die DDR (Folge 3)
In der dritten Folge von „Da war doch was“ geht es weniger um die DDR selbst, als vielmehr um die Diskussionen über sie. Denn auch drei Jahrzehnte nach ihrem Ende wird noch oft und viel über den SED-Staat geredet. Und manchmal wird es dabei auch sehr emotional. Wie wird über die DDR geredet und warum so oft falsch? Über dieses Thema spricht Thomas Klug mit Dr. Anna Kaminsky, Direktorin der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Fri, 16 Feb 2024 - 43min - 1122 - Deutsch-deutsche Dolmetscher. 50 Jahre Westkorrespondenten in der DDR
Im September 1973 wird Dietmar Schulz als dpa-Journalist in der DDR akkreditiert. Bald sind das öffentlich-rechtliche Fernsehen, der Rundfunk und die großen westdeutschen Zeitungen mit Journalisten im anderen Deutschland vertreten. Fünf von ihnen haben wir zu einem Zeitzeugengespräch eingeladen: Neben Dietmar Schulz, der bis 1979 in der DDR arbeitete, sind am Freitag, 13. Oktober, ab 14 Uhr Peter Pragal (1974 bis 1979 für die Süddeutsche Zeitung, 1983 bis 1991 für den stern), Harald Schmitt (1977 bis 1983 als Fotograf für den stern), Hendrik Bussiek (1977 bis 1985 für den ARD Rundfunk) und Monika Zimmermann (ab 1987 für die FAZ) in der Bundesstiftung zu Gast.
Unser Kollege Dr. Ulrich Mählert wird mit den Westkorrespondenten in lockerer Runde und ohne Zeitvorgabe über ihren Alltag in der DDR sprechen. Wie war es, zum Teil mit der ganzen Familie, in der DDR zu leben? Wie gestaltete sich die Arbeit vor Ort? Wie war das eigene Selbstverständnis und wie hat es sich verändert? Wie versuchten die „Dienste“ in Ost, aber auch in West, die Journalisten abzuschöpfen, zu manipulieren oder gar für sich einzuspannen?Fri, 13 Oct 2023 - 2h 33min - 1121 - Demokratischer (Un-)Wille? Der Umgang mit antidemokratischem Protest
Weltweit gehen Menschen für ihre Überzeugungen auf die Straße oder begehren – oft unter großen persönlichen Risiken – gegen Diktaturen auf. Sie eint der Wille zu Veränderungen: Am 17. Juni 1953 etwa erhoben sich über eine Million Menschen in der DDR für bessere Lebensverhältnisse und demokratische Reformen gegen das SED-Regime. 1989 demonstrierten Hunderttausende für Freiheit und Demokratie und brachten mit ihrem Willen zum Wandel Mauer und kommunistische Diktatur zu Fall.
Nicht zuletzt aufgrund der Errungenschaften der Friedlichen Revolution sind Widerstand und Protest in der deutschen Erinnerungskultur positiv besetzt, sie gelten als wichtige Ressource für Demokratie und Fortschritt. Doch wie umgehen mit Protest, der sich gesellschaftlichem Wandel verweigert? Was tun, wenn Pegida, Querdenken und Anti-Globalisierungsproteste die liberale Demokratie selbst zum Feind erklären? Die Veranstaltung geht diesen Fragen nach und diskutiert insbesondere, weshalb antidemokratische Proteste gerade in Ostdeutschland stark sind, wo Menschen 1953 und 1989 für Demokratie auf die Straße gingen.Tue, 10 Oct 2023 - 1h 29min - 1120 - "Über unsere Köpfe hinweg? Zum Narrativ der deutschen Einheit"
Wie vollzog sich 1990 politisch die deutsche Einheit? Über 30 Jahre lang dominierten hier in Politik und Öffentlichkeit die Deutungen des westdeutschen „Machens“ (Kohl) oder der „westdeutschen Übernahme“ der DDR. Doch die DDR ging 1990 weder als Unrechtsstaat noch als Diktatur in die deutsche Einheit über. Ihre 1990 nach der Friedlichen Revolution frei und demokratisch gewählte DDR-Regierung, ihre Minister und Staatssekretäre verhandelten mit der Bundesregierung die deutsche Einheit, bilateral wie international (Zwei-Plus-Vier-Vertrag). Dabei vertraten sie zentrale Anliegen der damaligen DDR-Bürger. Dieser Prozess war komplex, ist bis heute nicht erforscht und im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent. Was wurde erreicht? Wo setzten sich westliche Interessen durch? Fest steht, dass die deutsche Einheit am 3. Oktober 1990 das Ergebnis dieser Verhandlungen zweier demokratisch legitimierter deutscher Staaten war.
Die Veranstaltung diskutiert und vertieft, wie es dazu kam, warum das Narrativ einer „verhandelten Einheit“ nach wie vor keinen Platz in der öffentlichen Gedenkkultur, in Gedenkveranstaltungen und Schulbüchern findet. Darüber hinaus wird der Bogen gespannt zur gegenwärtigen Rolle Ostdeutschlands in der deutschen Gesellschaft und Demokratie.Tue, 26 Sep 2023 - 2h 09min - 1119 - Wer gehört zum „Wir“? Zugehörigkeiten und Identitätsvorstellungen im Vereinigungskontext
Ostdeutsch gegen westdeutsch, deutsch gegen nicht-deutsch – seit 1990 wird darüber gestritten, wer dazugehört. Die Spannungen zwischen dem großen „Wir“ der Bundesrepublik nach der deutschen Einheit und den vielen „Wirs“, mit ihren mannigfaltigen Zugehörigkeiten und unterschiedlichen Teilhabevorstellungen bestimmen die derzeitigen Debatten in Medien und Politik. Wer gehört somit nach welchen Kriterien zu welchem „Wir“, und welche Konsequenzen haben die unterschiedlichen Versuche, ein solches „Wir“ zu bestimmen? Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der deutschen Zweistaatlichkeit sind diese Fragen aktueller denn je.
Wir wollen den internationalen Tag der Demokratie nutzen, um in der Reihe „Wir müssen reden!“ mit unseren Gästen über diese Fragen zu diskutieren. Vorgestellt wird zugleich der neue Band des „Jahrbuchs Deutsche Einheit“, der sich der Frage nach Zugehörigkeiten und Identitätsvorstellungen im Vereinigungskontext widmet. Das Jahrbuch Deutsche Einheit wird seit 2020 von Dr. Marcus Böick, Prof. Dr. Constantin Goschler und Prof. Dr. Ralph Jessen in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung Aufarbeitung herausgegeben.Fri, 15 Sep 2023 - 1h 35min - 1118 - Traum und Terror – 50 Jahre nach dem Militärputsch in Chile
Am 11. September 1973 putschte sich das Militär unter der Führung von Augusto Pinochet in Chile an die Macht und stürzte den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. In den Jahren der Militärdiktatur geschahen zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und das Land wurde nach den Prinzipien des Neoliberalismus umgestaltet. Erst 1990 gelang es, zur Demokratie zurückzukehren. Heute ist Chile zwar einerseits eines der wirtschaftlich stärksten Länder Südamerikas, aber andererseits auch eines der ungleichsten Länder der Welt. 2019 und 2020 erschütterten Proteste nach mehr sozialer Gerechtigkeit und einer neuen Verfassung das Land.
Den 50. Jahrestag des Militärputsches nimmt die Bundesstiftung Aufarbeitung zum Anlass, um in drei Stehtischrunden über die zentralen Aspekte der chilenischen Geschichte zu diskutieren, das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zu Chile zu erörtern und den Status quo der Aufarbeitung der Militärdiktatur ins Auge zu fassen.Mon, 11 Sep 2023 - 1h 50min - 1117 - 25 Jahre Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Mit etwa 400 Gästen beging die Bundesstiftung Aufarbeitung am 30. August im Rahmen der Zeitgeschichtlichen Sommernacht ihr 25-jähriges Jubiläum. In der Villa Elisabeth in Berlin-Mitte blickte Direktorin Dr. Anna Kaminsky mit Wegbegleitern, Mitarbeitern und Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft nicht nur auf die vergangenen 25 Jahre zurück, sondern ordnete die Stiftung und ihre Arbeit auch in den aktuellen gesellschaftlichen Kontext ein. Den Festvortrag „Von der Notwendigkeit und Kunst des Erinnerns“ hielt die Regionalbischöfin der Ev.-luth. Landeskirche Hannover und Mitglied des Deutschen Ethikrates, Dr. Petra Bahr. Ebenso sprachen Katrin Göring-Eckart, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, und Maria Bering, Abteilungsleiterin „Erinnerungskultur“ bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Musikalisch begleitet wurde der Festakt von „The Swingin‘ Hermlins“ unter der Leitung von Andrej Hermlin.
Wed, 30 Aug 2023 - 1h 25min - 1116 - Der Hitler-Stalin-Pakt
Vor 84 Jahren unterzeichneten die Sowjetunion und das NS-Regime am 23. August 1939 den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. Die Vereinbarung ebnete den Weg für den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939, mit dem der Zweite Weltkrieg begann. Wenige Tage später besetzte die Sowjetunion Ostpolen. Darüber hinaus hatten die Vertragspartner in einem geheimen Zusatzprotokoll die Aufteilung der Länder Ost- und Ostmitteleuropas in jeweilige Einflusssphären vereinbart. Was bedeutete dieser Pakt für die Nachbarländer der beiden Diktaturen? Welche Folgen hatte die Vereinbarung? Welche Erfahrungen machte die Bevölkerung in den von NS-Deutschland und der Sowjetunion in der Folge besetzten Ländern und Gebieten? Wie wird heute an den Pakt und seine Folgen erinnert und welche Chancen für eine europäische Erinnerungskultur liegen darin, an dieses Ereignis zu erinnern?
Mon, 21 Aug 2023 - 1h 37min - 1115 - Zwischen Recht und Repression – Protest und Staatsmacht
Das bekannteste Foto vom 17. Juni 1953 zeigt ein ungleiches Duell: zwei Männer, die Steine gegen einen Panzer werfen. Die Erinnerung an den Volksaufstand in der DDR ist immer auch die an seine gewaltsame Niederschlagung – zu der neben dem Einsatz sowjetischer Panzer auch die größte Verhaftungsaktion in der Geschichte des SED-Regimes gehörte.
Die Veranstaltung widmet sich der Frage, wie autoritäre Regime in Vergangenheit und Gegenwart auf Widerstand reagier(t)en: von der Abschaltung des Internets, NGO-Verboten, Verhaftungen bis hin zu Hinrichtungen. Dabei diskutieren und schildern unsere Gäste auch aus eigener Perspektive, wie Gewalt und Repression auf Protestbewegungen wirken. Zugleich nimmt das Podium Demokratien in den Blick und erörtert, wie diese mit Protestaktionen und zivilem Ungehorsam umgehen und wie staatliche Instrumente wie Präventivhaft oder die Verhältnismäßigkeit von Polizeieinsätzen in demokratischen Gesellschaften diskutiert werden.Sat, 06 May 2023 - 1h 29min - 1114 - Wir müssen Reden! Enteignungen in der SBZ und DDR
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur nach sowjetischem Vorbild. Damit war nicht nur die politische Umgestaltung, sondern auch tiefgreifende wirtschaftspolitische Entscheidungen verbunden. Dazu gehörten rücksichtslos durchgeführte Enteignungen von Land- und Grundbesitz aber auch von Handwerks- und Industriebetrieben sowie dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Welche Forschungsergebnisse liegen heute mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung dazu vor?
Wed, 12 Jul 2023 - 1h 34min - 1113 - Stadt, Land, Netz – Protesträume im Wandel
Demonstrationszüge, Steinewerfer, Panzer, Straßenschlachten: Auch Fotos vom 17. Juni 1953 haben das deutsche Bildgedächtnis von Auf- und Widerstand geprägt. Tumulte auf den Straßen, Menschen vor Machtzentren, der öffentliche Raum im Ausnahmezustand – Massenproteste weltweit erzeugen heute ähnliche Bilder. Doch Protest regt sich nicht nur in öffentlichen Räumen, Revolten brechen nicht nur auf bekannten Plätzen aus: Der Volksaufstand in der DDR fand auch auf Dorfstraßen, in Belegschaftsräumen und auf Betriebsgeländen statt. Heute versammeln sich Menschen bei Netzdemos, entfachen Tweetstorms oder kämpfen als „Hacktivisten“ vom heimischen Computer aus für ihre Ziele.
In unserer Veranstaltung fragen wir, welche Räume Menschen nutz(t)en, um gegen autoritäre Regime aufzubegehren und ihren politischen Willen kundzutun. Wie vernetzen und stärken sich Protestbewegungen gegenseitig?
Tue, 04 Jul 2023 - 1h 34min - 1112 - Der lange Schatten der Diktatur – Posttraumatische Belastungen nach politischer Verfolgung
Auch mehr als 30 Jahre nach dem Ende der SED-Diktatur leiden zahlreiche Menschen an den Folgen der politischen Verfolgung. Psychischer Druck, Folter, Zersetzung der Persönlichkeit aber auch die Stigmatisierungen im Alltag haben oftmals komplexe Gesundheitsschäden und Traumatisierungen verursacht und wirken bis heute fort. Seit 2021 untersucht das länderübergreifende Forschungsverbundprojekt „Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht“ der Universitäten Magdeburg, Jena, Leipzig und Rostock erstmals auch die Begutachtungspraxis in Entschädigungsverfahren in der Breite, um so zu einer verbesserten Anerkennung und Behandlung der Betroffenen beizutragen.
Thu, 29 Jun 2023 - 1h 30min - 1111 - Nikolai Epplée: Die unbequeme Vergangenheit. Vom Umgang mit Staatsverbrechen in Russland und anderswo
Das Verbot der internationalen Menschenrechtsorganisation Memorial im Dezember 2021 war der letzte Schlag des Putin-Regimes gegen die russische Zivilgesellschaft. Zwei Monate später begann der großflächige Angriff auf die Ukraine. Dass sie den Krieg nicht verhindern konnten – mit dieser Erkenntnis schlagen sich vor allem diejenigen herum, die sich den Geschichtslügen der Kreml-Propaganda entgegengestellt hatten. Was ist aus der vielgestaltigen Aufarbeitungsszene in Russland geworden? Irina Scherbakowa, Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, und Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift „Osteuropa“, diskutieren mit dem Autor über die zentralen Fragen seines Buches. Es moderiert Uta Gerlant, Gründungsmitglied von MEMORIAL Deutschland.
Tue, 27 Jun 2023 - 2h 02min - 1110 - Wir müssen reden! „Fake News“ und „Meinungsfreiheit“
Folgt man Debatten in den sozialen Medien, kann man den Eindruck gewinnen, es gibt keine gesicherten Fakten oder Wahrheiten mehr. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten zehn Jahren grundlegend verändert. Was sind eigentlich »Fake News«? Wann wird eine abweichende Meinung zu »Fake« und wer entscheidet jeweils, was »wahr« oder »falsch« ist? Was ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und wo beginnt gezielte Desinformation und Lügen? Und wie kann man sich in den verschiedenen Meinungen und widersprüchlichen Darstellungen noch orientieren? Wie findet man sich im Informationsdschungel zurecht? Welche Medien gelten heute noch als vertrauenswürdig? Und welchen Einfluss hat das auf die historisch politische Bildungsarbeit?
Tue, 20 Jun 2023 - 1h 18min - 1109 - 70 Jahre danach – Zeitzeugen erinnern sich an den 17. Juni 1953
Rund vier Jahre nach Gründung der DDR kam es zu einem landesweiten Aufstand gegen den „Aufbau des Sozialismus“ und die zunehmende Stalinisierung der Gesellschaft. Fehlende Freiheitsrechte, die Kollektivierung der Landwirtschaft, Versorgungsengpässe und schließlich Erhöhungen der Arbeitsnorm ohne Lohnausgleich sorgten in der Bevölkerung für Unmut. Ausgehend von Ost-Berlin legten am 17. Juni 1953 über eine Millionen Menschen in mehr als 700 Städten und Dörfern die Arbeit nieder und demonstrierten. Sie forderten nicht nur wirtschaftliche Verbesserungen, sondern beispielsweise auch freie Wahlen und die „Aufhebung der Zonengrenzen“. Die Proteste wurden durch sowjetische Panzer jäh beendet und vielerorts wurde der Ausnahmezustand verhängt. Mehrere Dutzend Menschen kamen beim Volksaufstand am 17. Juni 1953 ums Leben, Tausende wurden festgenommen und zu langen Haftstrafen verurteilt.
Zeitzeugen und Wissenschaftler tauschen sich auf dem Podium zu verschiedenen Aspekten des Volksaufstandes aus: Aus welchen Gründen und mit welchen Forderungen begehrte die DDR-Bevölkerung auf? Wie haben Zeitzeugen die Ereignisse erlebt? Wie beeinflusste der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 die Entwicklung der noch jungen DDR? Welche Wahrnehmung gab es in der Bundesrepublik und wie gestaltet sich die Erinnerung heute?Tue, 16 May 2023 - 1h 28min - 1108 - Akten und Macht. Deutsche Zentralarchive in den Systemumbrüchen des 20. Jahrhunderts
Als Gedächtnis einer Gesellschaft sind Archive wohl bekannt, als politisch umkämpfte Institutionen hingegen weniger. Archivarinnen und Archivare sahen sich im 20. Jahrhundert mehrfach mit diktatorischen Regimen konfrontiert, die ihre Führungsansprüche und Ideologie auch im Archivwesen durchzusetzen trachteten. Der Historiker Peter Ulrich Weiß hat in einer neuen Studie exemplarisch die Entwicklung des Reichsarchivs Potsdam und seiner Nachfolgeeinrichtungen Bundesarchiv und Deutsches Zentralarchiv der DDR nach 1933 und 1945 untersucht. Seine Ergebnisse bilden den Ausgangspunkt für eine gemeinsame Diskussion über die Folgen radikaler Systemumbrüche für deutsche Zentralarchive, den Umgang mit Diktaturbelastungen und Grauzonen zwischen Mitmachen und Verweigern sowie das besondere Integrationsvermögen dieser Expertenkultur über politische Zäsuren hinweg. Hierbei werden auch die Entwicklungen nach 1989/90 in den Blick genommen.
Tue, 02 May 2023 - 1h 35min - 1107 - Erinnerungsdebatten. Vom Umgang mit der Vergangenheit 1989–1992
Mit dem neuen Online-Portal www.erinnerungsdebatten.de stellt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine umfangreiche Dokumentation der parlamentarischen Debatten über den Umgang mit der NS- und der SED-Vergangenheit zur Verfügung, die von 1989 bis 1992 geführt wurden.
Das Portal dokumentiert die Diskussionen der Vertreterinnen und Vertreter des Zentralen Runden Tisches in der DDR, der letzten und zugleich frei gewählten DDR-Volkskammer sowie des Deutschen Bundestages vor und nach Herstellung der deutschen Einheit. Hinzu kommen historische Dokumente, Fotos, Videos und Tonmitschnitte. Herzstück der Seite sind zahlreiche Interviews mit den damaligen politischen Akteurinnen und Akteuren.Thu, 20 Apr 2023 - 1h 27min - 1106 - "Das ist (nicht) unser Krieg"
Am 24. Februar 2022 überfiel Russland mit seinen Truppen die Ukraine und versuchte das Land zu besetzen. Die russische Seite begründete den Einmarsch unter anderem mit einer angeblich notwendigen „Entnazifizierung“ des Nachbarlandes. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte am 27. Februar 2022, der russische Überfall auf die Ukraine markiere eine „Zeitenwende“. Putin habe „kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen“. Er sicherte der Ukraine die volle Unterstützung zu. Mittlerweile dauert die russische Invasion ein Jahr und die deutsche Öffentlichkeit diskutiert kontrovers über den Krieg und die deutsche Unterstützung. Während eine Mehrheit Waffenlieferungen für die Ukraine befürwortet, wehren sich andere unter dem Slogan „Das ist nicht unser Krieg“ dagegen.
Thu, 23 Feb 2023 - 1h 45min - 1105 - Spiel ohne Grenzen? Fußball in der Transformation
Am 19. Januar 2023 blicken wir ab 18 Uhr zurück auf den Prozess der deutschen Einheit auf dem grünen Rasen. Wie bewältigten die Ost-Klubs die doppelte Transformation der Fußballeinheit und der forcierten Globalisierung seit Mitte der 1990er Jahre? Wie unterscheidet sich die Erinnerung an den Nationalsozialismus im Vereinswesen in Ost und West? Woher rührte die Gewaltwelle in den Stadien der 1990er Jahre?
Sun, 19 Feb 2023 - 1h 53min - 1104 - Auftaktveranstaltung zur Tagung "Die langen Schatten der Verfolgung" und Premiere des Jahrbuchs für Historische Kommunismusforschung 2023
Abschlusstagung des Forschungsverbunds „Landschaften der Verfolgung“. Der Forschungsverbund „Landschaften der Verfolgung“ untersucht seit 2019 die politische Repression in der DDR. Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Verbund hat dabei Grundlagenarbeit zum Verständnis des SED-Regimes und seiner bis in die Gegenwart reichenden Folgen geleistet. In der Abschlusstagung am 16./17. Februar 2023 in und mit der Bundesstiftung Aufarbeitung bilanzieren Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Politik die bisherige Arbeit. Thema sind insbesondere die Bedeutung quantitativer Forschungsdaten für die Aufarbeitung politischer Haft in der DDR, die Spätfolgen von Hafterfahrungen sowie die Frage nach Gerechtigkeit in der Transformation. Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung bis zum 8. Februar 2023 wird gebeten.
Zudem wird das Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2023 von Robert Kindler und Ulrich Mählert vorgestellt. Es ist die 30. Ausgabe der Jahresschrift, die 1993 von Hermann Weber in Mannheim gegründet worden war.Thu, 16 Feb 2023 - 2h 28min - 1103 - 1968 und der Prager Frühling – Wahrnehmungen in Ost und West
Im Jahr 1968 kulminierten Protestbewegungen weltweit. Die erste Nachkriegsgeneration war erwachsen und hinterfragte in Ost wie West die politischen und gesellschaftlichen Maßstäbe der Älteren. Die jeweiligen Reformbestrebungen standen unter den Vorzeichen des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation. Im Osten war mit dem Prager Frühling die große Erwartung verbunden, einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ zu schaffen. Die gewaltsame Niederschlagung des Aufstandes durch Truppen des Warschauer Paktes bewirkte über die Grenzen der ČSSR eine Desillusionierung, aber auch Politisierung der 68er-Generation.
Thu, 09 Feb 2023 - 1h 35min - 1102 - Demokratien im Dialog: Demokratischer Wandel und Menschenrechte in Taiwan
Taiwan ist eine der dynamischsten und modernsten Demokratien Asiens. Taiwan hat in seiner wechselvollen Geschichte aus eigener Kraft in einem mühevollen und friedlichen Prozess etwas geschaffen, das modellhaft für die ganze südostasiatische Region ist. Taiwan ist heute ein Leuchtturm für Demokratie und Menschenrechte. Gleichzeitig erleben wir in diesen Monaten eine sich stetig aufbauende Bedrohung Taiwans. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte und als Zeichen für die Ausstrahlungskraft und geopolitische Bedeutung der lebendigen Demokratie Taiwans begrüßen die Deutsch-Taiwanische Gesellschaft und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Chen Chu als Vorsitzende der Nationalen Menschenrechtskommission Taiwans.
Die Begrüßung halten Dr. Anna Kaminsky, Dr. Marcus Faber und Prof. Jhy-Wey Shieh. Es referieren Chen Chu und Prof. Dr. Eibe Riedel. Auf dem Podien diskutieren Dr. Renate Müller-Wollermann und Dr. Rong-Jye Lu sowie Peter Heidt, Dr. Gudrun Wacker und Martin Aldrovandi.Mon, 12 Dec 2022 - 2h 16min - 1101 - 30 Jahre SED-Unrechtsbereinigungsgesetze
Am 4. November 1992 trat nach langen Beratungen das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland (StrRehaG) in Kraft. Rund 30 Jahre sind seit Einführung des ersten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes vergangen. Was ist erreicht worden? Welche Fragen sind offen? Wo besteht noch dringender Verbesserungsbedarf?
Diese Fragen wurden am 28.11.2022 von Evelyn Zupke, Dieter Dombrowski und Hansgeorg Bräutigam auf dem Podium in der Bundesstiftung Aufarbeitung diskutiert.Mon, 28 Nov 2022 - 1h 37min - 1100 - 30 Jahre Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung von Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in SBZ und DDR
Am 12. März 1992 beschloss der Deutsche Bundestag fraktionsübergreifend die Einsetzung einer Enquete-Kommission zur Aufarbeitung von Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in SBZ und DDR. Die Initiative hierzu war ursprünglich vom SPD-Abgeordneten Markus Meckel ausgegangen. Am 20. Mai 1992 nahm die Kommission ihre Arbeit auf. 30 Jahre danach ziehen wir eine erinnerungspolitische Bilanz und richten zugleich den Blick auf die Gegenwart und Zukunft der Diktaturaufarbeitung in Deutschland.
Wed, 29 Jun 2022 - 4h 02min - 1099 - Ohne Geschichte? Verdrängung der Vergangenheit in Spanien, Portugal und Griechenland
In der siebten Veranstaltung der Reihe "Transitional Justice" geht es um die oft „vergessenen Diktaturen“ in Spanien, Portugal und Griechenland, die bis in die 1970er Jahre existierten. Jahrelanges Schweigen über die diktatorische Vergangenheit behinderte wichtige Aufarbeitungsprozesse. Erst seit Kurzem wird darüber gesprochen. Vor welchen Herausforderungen und Aufgaben stehen die demokratischen Gesellschaften beim Umgang mit ihrer diktatorischen Geschichte heute? Darüber sprach Tamina Kutscher von Dekoder.org am 25.01.2022 mit Prof. Dr. Luís Farinha, Prof. Dr. Gutmaro Gómez Bravo und PD Dr. Adamantios Skordos.
Tue, 25 Jan 2022 - 1h 19min - 1098 - Busludscha oder Belene? Kommunismusaufarbeitung in Bulgarien
Seit 2013 setzt sich die Sofia Platform Foundation für die Aufarbeitung der kommunistischen Diktaturvergangenheit in Bulgarien ein. Besondere Aufmerksamkeit widmet die NGO dem Straflager Belene, das 1949 auf der gleichnamigen Donauinsel an der Grenze zu Rumänien errichtet worden war. Bis 1987 wurden unter der Herrschaft der Kommunisten zahlreiche Regimegegner sowie so genannte "Konterrevolutionäre" auf die Insel deportiert und viele davon ermordet.
Während dieser Ort der Repression bis heute ein Schattendasein führt, erfährt der nationalkommunistische Busludscha-Komplex weitaus mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Das 1981 und bereits 1989 wieder geschlossene Kongresszentrum thront wie ein UFO auf einem 1400 Meter hohen Berg.Wed, 21 Jun 2023 - 2h 00min - 1097 - Kerze, Schirm und abgeschnittenes Haar – Symbole von Protest und Widerstand
Die Demonstranten der Leipziger Montagsdemonstrationen hielten Kerzen in den Händen, die zu einem Symbol der Friedlichen Revolution wurden. Als 2014 in Hongkong tausende Menschen mit Regenschirmen für mehr Demokratie auf die Straße gingen, sprachen Medien von der „Regenschirm-Revolution“. Seit dem Tod von Masha Amini im September 2022 schneiden sich Frauen weltweit die Haare ab als Zeichen der Solidarität für die protestierenden Menschen im Iran.
In unserer Veranstaltung fragen wir, wie Widerstand aussieht.Tue, 06 Jun 2023 - 1h 18min - 1096 - Treuhand – Alltag einer umstrittenen Behörde
Für die Überführung einer sozialistischen Planwirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft gab es keinen Masterplan. Die Treuhandanstalt, die im Kern auf einen Beschluss der Modrow-Regierung zur Errichtung einer „Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums“ zurückging, als unmittelbare Bundesbehörde steht bis heute für diese Umgestaltung. Die konkrete Umsetzung, eine Mischung aus Improvisationen, weitreichenden Entscheidungen und umfangreichen Verantwortungen, lag in den Händen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Behörde.
Wer waren die Menschen, die den Aufbau einer leistungs- und wettbewerbsfähigen modernen Wirtschaft vorantreiben sollten? Wie war ihr beruflicher Werdegang? Wie waren Ihre Verbindungen zu Ostdeutschland? Wie haben sie ihre Rolle gesehen und diese gestaltet? Und nicht zuletzt wie sah ihr Arbeitsalltag aus? War die Treuhand eine gesamtdeutsche Angelegenheit oder ein ostdeutsches Phänomen? Diese Fragen werden auf einem Podiumsgespräch mit damals Beteiligten diskutiert.Wed, 31 May 2023 - 1h 48min - 1095 - Protest und Erinnerung
125 Jahre Märzrevolution von 1848, 70 Jahre Volksaufstand vom 17. Juni 1953: Im Jahr 2023 wird in Deutschland an gleich zwei Revolutionen erinnert, in denen Menschen für Freiheit, Demokratie und Einheit auf die Straße gingen. Doch während die Märzrevolution als Teil der europäischen Demokratiebewegung gilt, wird der Volksaufstand vom 17. Juni häufig als bloße DDR-Geschichte wahrgenommen. Dies wird der gescheiterten Revolution nicht gerecht, stand sie doch am Anfang zahlreicher Freiheitserhebungen im kommunistischen Machtbereich, deren Ziele 1989/1991 erfüllt wurden.
Vor diesem Hintergrund diskutiert die öffentliche Abendveranstaltung der Tagung »Protest! Aufstand und Aufbegehren in Diktatur und Demokratie – Geschichte und Gegenwart«, wie Protest und Widerstand erinnert werden.Thu, 25 May 2023 - 1h 35min - 1094 - Protest! Aufstand und Aufbegehren in Diktatur und Demokratie - Geschichte und Gegenwart
Lautstark auf der Straße, heimlich im Verborgenen, global im Netz: Menschen finden vielfältige Wege, ihren politischen (Un-)Willen zu bekunden. Wofür bzw. wogegen sie protestieren und mit welchem Risiko sie aufbegehren, hängt ganz wesentlich vom politischen System ab: Während Demokratien Versammlungsfreiheit gewähren und von der Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger leben, unterdrücken Diktaturen Proteste und schlagen Aufstände nieder.
Anlässlich des 70. Jahrestags des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 diskutiert die Tagung das demokratische Potenzial von Protest: Trägt er die Demokratie und erträgt sie ihn? Wie viel gesellschaftliche Binde- bzw. Sprengkraft besitzt politischer Aktivismus und wie verändert er die politische Kultur? Was kann Protest gegen autoritäre Regime bewirken und welche Risiken gehen aufständische Menschen ein? Und lassen sich Akteure, Anliegen und Aktionsformen widerständiger Bewegungen in Demokratie und Diktatur überhaupt vergleichen? Expertinnen und Experten sowie Träger historischer und gegenwärtiger Proteste beleuchten übergreifende Aspekte wie Protestformen und -bedingungen, Kommunikation, und Erinnerung und mögliche gesellschaftliche Lernprozesse. Das Publikum wird durch interaktive und partizipative Methoden eingeladen, eigene Erfahrungen und Perspektiven einzubringen.Thu, 25 May 2023 - 4h 13min - 1093 - Wahrheit oder Gerechtigkeit? Transitional Justice in Afrika
Die neunte Veranstaltung in der Reihe „Transitional Justice „Wahrheit oder Gerechtigkeit? Transitional Justice in Afrika“ lenkt den Blick auf einen Kontinent zwischen ethnischen Konflikten, institutionalisiertem Rassismus und krasser Armut sowie auf Staaten im Spannungsfeld von massiven internationalen Interessen und nationalen Befreiungskämpfen. Am 12.04.2022 diskutierten Dr. Khulu Mbatha, Sonderberater des Präsidenten von Südafrika und Pretoria Wachira Waheire, Mitglied der Kommission für Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung in Kenia. Moderiert wurde die Veranstaltung von Tamina Kutscher, Chefredakteurin von dekoder.org.
Tue, 12 Apr 2022 - 1h 07min - 1092 - Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit
Am 20.6.2022 haben wir live aus dem Berliner Futurium die Preisverleihung zum Jugendwettbewerb „Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit. Thema 2021/2022: Jungsein“ gesendet. Es beteiligten sich insgesamt fast 750 Jugendliche aus 13 Bundesländern am Wettbewerb. Die 152 eingereichten Beiträge reichten von Podcasts und Filmen über Comics und Ausstellungen bis zu Spielen und Tagebüchern.
Den ersten von drei Hauptpreisen erhiehlen Lucia, Stella und Sophia vom Neues Gymnasium Leibnitz. 3.000 Euro für "Spiel, Satz und Wende!" - eine interaktive Kurzgeschichte über ostdeutsche Handball-Nachwuchssportler nach 1989. Max, Tom und Marco vom Gymnasium Michelstadt in Hessen sind die zweiten Gewinner des Hauptpreises. Sie konnten mit ihrer Website und einem beeindruckenden Video zu "Fürs Leben gelernt? Schulalltag in der DDR kurz vor der Wende" überzeugen. Ein weiterer erster Platz ging nach Hessen. Mit ihrem Theaterstück "Zwischen Trabbi und Käfer" erzählen Carolin & Tijan von der Internatsschule Schloss Hansenberg über Subkulturen in der DDR und deren Transformationserfahrungen.
Moderiert wird die Veranstaltung von dem Journalisten und YouTuber Mirko Drotschmann alias MrWissen2Go. Alle Infos zum Jugendwettbewerb gibt es auf www.umbruchszeiten.deMon, 20 Jun 2022 - 1h 19min - 1091 - Karl-Wilhelm-Fricke-Preis 2022
Mit dem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis möchten wir das Engagement derjenigen sichtbar machen, die sich über Jahrzehnte weltweit mit Zivilcourage und Mut gegen Diktaturen und autoritäre Herrschaft sowie für demokratische Rechte und Freiheiten eingesetzt haben. Ausgezeichnet werden mit dem von Dr. Burkhart Veigel gestifteten Preis Einzelprojekte, Persönlichkeiten und Initiativen, die mit ihrer Arbeit das Bewusstsein für Freiheit, Demokratie und Zivilcourage stärken. Die Preisverleihung 2022 fand am 16. Juni statt.
Der Hauptpreis ging an die Menschenrechtsorganisation MEMORIAL INTERNATIONAL, den Sonderpreis erhielt die Zeitschrift OSTEUROPA. Der Nachwuchspreis 2022 ging an die beiden Macher des Podcasts „Horchpost DDR“, Max Zarnojanczyk und Christian Hermann.
Claudia Roth MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien, hat die Preisträgerinnen und Preisträger mit einem Grußwort gewürdigt.Thu, 16 Jun 2022 - 2h 05min - 1090 - Zwischen Siegpodest und „Damnatio Memoriae“: Sportlerbilder im 20. Jahrhundert
Anlass der ersten Veranstaltung der Reihe "Im Lauf durch die Epochen: Sport und Systemwechsel im 20. Jahrhundert" war das 30-jährige Jubiläum der ersten gesamtdeutschen Spiele nach dem Kalten Krieg in Albertville 1992. Prof. Dr. Diethelm Blecking, Kateryna Chernii, Wolfgang Rattay , Rica Reinisch und Prof. Dr. Annette Vowinckel haben am 17.03.2022 auf die heikle politische Rolle der Sportidole zurückgeblickt. Dabei sind sie unter anderem der Frage nachgegangen, wie sich Selbstbild und Inszenierung von Athletinnen und Athleten im Lauf der Epochen wandelten und sich Ästhetik und Arbeitsbedingungen der Sportfotografie veränderten.
Thu, 17 Mar 2022 - 1h 55min - 1089 - Gewalt und Widerstand – Wahrheitskommissionen in Lateinamerika
Thema der achten Veranstaltung der Reihe „Transitional Justice“ waren die Aufarbeitungsprozesse in Argentinien, Chile und Kolumbien, die trotz juristischer Defizite und Amnestiegesetze eingeleitet und gefördert wurden. Am 01.03.2022 waren Ximena Vanessa Goecke, Salomé Grunblatt und María Paula Gamboa zu Gast.
Tue, 01 Mar 2022 - 1h 20min - 1088 - Verleihung des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises 2023
Mit ihrem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis möchte die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur das Engagement derjenigen sichtbar machen, die sich über Jahrzehnte weltweit mit Zivilcourage und Mut gegen Diktaturen und autoritäre Herrschaft sowie für demokratische Rechte und Freiheiten eingesetzt haben und einsetzen. Ausgezeichnet werden mit dem von Dr. Burkhart Veigel gestifteten Preis Einzelprojekte, Persönlichkeiten und Initiativen, die mit ihrer Arbeit das Bewusstsein für Freiheit, Demokratie und Zivilcourage stärken.
Thu, 15 Jun 2023 - 2h 08min - 1087 - Da war doch was: Der Mauerbau am 13. August 1961 (Folge 2)
Am 13. August 1961 wird die Grenze zwischen Ost und West abgeriegelt. Straßen werden aufgerissen, Panzersperren und Stacheldraht errichtet. Die Berliner Bevölkerung ist schockiert. In den folgenden Tagen wird der Stacheldraht durch eine ca. 2 m hohe Mauer ersetzt. Familien werden getrennt, über 50.000 Ostberliner können ihre Arbeitsplätze im Westen nicht mehr erreichen und Grenzsoldaten schießen auf Menschen, die über die Grenze fliehen wollen. Laut DDR-Regierung soll die Mauer die Bürger im Osten vor den Faschisten im Westen schützen. Mehr über die Vorgeschichte und den Verlauf des Mauerbaus erfahren Sie in dieser Folge von „Da war doch was - Geschichten zwischen Kap Arkona und Fichtelberg“. Zu Wort kommt der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Prof. Axel Klausmeier.
Wed, 02 Aug 2023 - 32min - 1086 - Da war doch was: Der 17. Juni 1953 (Folge 1)
Der Sprecher der Sowjetischen Militäradministration klingt hochoffiziell, als er die Meldung vom Ausnahmezustand in der DDR verkündet. Ein Reporter des Westberliner RIAS berichtet von den Ereignissen am Brandenburger Tor. Und der Chef-Propagandist der SED, Karl-Eduard von Schnitzler, erklärt alles, was in jenen Tagen in der DDR passiert als etwas, was vom Westen gesteuert wird. Der 17. Juni 1953 offenbart den Kontrollverlust der Staatspartei - und genau deshalb wird in der DDR nie offen über diese Ereignisse gesprochen. Die erste Folge von „Da war doch was – Geschichten zwischen Kap Arkona und Fichtelberg“ beschreibt die Vorgeschichte und den Verlauf des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953. Zu Wort kommt u.a. unser Kollege Dr. Ulrich Mählert.
Podcast-Reihe "Da war doch was":
Was geschah am 17. Juni 1953? Auf wessen Betreiben wurde die Berliner Mauer gebaut? Wie gestaltete sich der Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker? Welche Ursachen führten zur Friedlichen Revolution? Diese und andere Fragen können Thema des neuen Audiopodcasts der Bundesstiftung Aufarbeitung sein. In den 30minütigen Hörstücken kommen Wissenschaftler und Zeitzeugen zu Wort. Bekannte und unbekannte O-Töne führen die Hörer zurück in die Zeit der deutschen Teilung. Konzipiert und realisiert werden diese Bildungsangebote von Thomas Klug, der als freier Journalist für den Rundfunk tätig ist.Tue, 09 May 2023 - 30min - 1085 - Gesellschaft im Wandel? Der Blick der »Generation Einheit« auf die Transformation - Tag 2
Auch mehr als 30 Jahre nach der deutschen Einheit scheint die einstige Teilung des Landes die Identität der »Generation Einheit« zu prägen. Geboren zwischen 1975 und 1985, ist diese Generation der »Wendekinder « inzwischen 35 bis 45 Jahre alt. Sie umfasst knapp zweieinhalb Millionen Menschen – die in der DDR aufgewachsen und in der Umbruchzeit erwachsen geworden sind. Doch worin bestehen die Prägungen dieser Menschen, die längst die Lebenswirklichkeit in diesem Land entscheidend mitbestimmen? Welche Themen sind im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels für die junge(n) Generation(en) gegenwärtig und künftig relevant? Auf welchen Feldern gibt es Fort- oder sogar Rückschritte? Vor welchen Herausforderungen steht die vergleichende Transformationsforschung?
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Tagung, die Stimmen und Eindrücke der »Generation Einheit« einfangen und mit wissenschaftlichen Ergebnissen zur Transformation rückkoppeln soll. In der Veranstaltung werden partizipative und interaktive Methoden eingesetzt, die alle Beteiligten einbinden und über Umbruchserfahrungen generationsübergreifend miteinander ins Gespräch kommen lassen.Wed, 16 Nov 2022 - 2h 23min - 1084 - Gesellschaft im Wandel? Der Blick der »Generation Einheit« auf die Transformation - Tag 1
Auch mehr als 30 Jahre nach der deutschen Einheit scheint die einstige Teilung des Landes die Identität der »Generation Einheit« zu prägen. Geboren zwischen 1975 und 1985, ist diese Generation der »Wendekinder « inzwischen 35 bis 45 Jahre alt. Doch worin bestehen die Prägungen dieser Menschen, die längst die Lebenswirklichkeit in diesem Land entscheidend mitbestimmen? Welche Themen sind im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels für die junge(n) Generation(en) gegenwärtig und künftig relevant? Auf welchen Feldern gibt es Fort- oder sogar Rückschritte? Vor welchen Herausforderungen steht die vergleichende Transformationsforschung?
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Tagung, die vom 15. bis 16.11.2022 in der Bundesstiftung Aufarbeitung stattfindet. Dabei werden partizipative und interaktive Methoden eingesetzt, die alle Beteiligten einbinden und über Umbruchserfahrungen generationsübergreifend miteinander ins Gespräch kommen lassen.Tue, 15 Nov 2022 - 2h 03min - 1083 - Auf dem linken Auge blind? Der Umgang mit dem Kommunismus im vereinten Deutschland
Vor 25 Jahren erschien in Frankreich das »Schwarzbuch des Kommunismus«. Anlass war der 80. Jahrestag der russischen »Oktoberrevolution« 1917. Ein Jahr später löste die deutsche Ausgabe des Schwarzbuches eine heftige Kontroverse über die Dimensionen und die Bewertung der kommunistischen Verbrechen im 20. Jahrhundert aus. Am 14. November 2022 sprach Dr. Ulrich Mählert mit Prof. Dr. Claudia Weber, Albrecht von Lucke und Prof. Dr. Peter Steinbach über den Ort des Kommunismus in der Erinnerungskultur des vereinten Deutschlands.
Mon, 14 Nov 2022 - 1h 38min - 1082 - DDR-Tourismus – Reisen in Grenzen
Der DDR-Tourismus wandelte sich bis in die 1980er-Jahre von einem privatwirtschaftlichen zu einem weitgehend staatlich gelenkten Sektor. Zu den Institutionen, die das Reisen organisierten und reglementierten, gehörten die Betriebe, der FDGB-Feriendienst und Jugendtourist. Welche Funktionen hatte das Reisen im Sozialismus? Wie war der staatlich gelenkte Tourismus organisiert? Welche Einschränkungen und Freiräume gab es? Und trug die eingeschränkte Reisefreiheit nur zur Destabilisierung des Systems DDR bei oder stützte sie dieses auch?
Am 10.11.2022 diskutierten Detlef Berg, Claudia Rusch und Prof. Dr. Hasso Spode in der Bundesstiftung Aufarbeitung . Die sechste Veranstaltung der Reihe "Zeitzeugenperspektiven" wurde moderiert von Robert Ide.Thu, 10 Nov 2022 - 1h 14min - 1081 - Berlin – Stadt der Einheit?
Berlin steht sinnbildlich für das Zusammenwachsen der Deutschen in Ost und West. Wie unter einem Brennglas lassen sich hier die Transformationsprozesse der vergangenen mehr als 30 Jahre deutscher Einheit beobachten. Doch wie sehr prägt die Geschichte die Gegenwart Berlins, wie gut sind die beiden Stadthälften mittlerweile zusammengewachsen und wie lebt es sich heute in der ehemals geteilten Stadt? Lassen sich noch Unterschiede zwischen Ost und West erkennen oder sind längst andere Trennlinien entscheidend? Welche Entwicklungschancen bieten sich der wirtschaftlich aufstrebenden, weltoffenen, gesellschaftlich und kulturell vielfältigen deutschen Hauptstadt?
Am 01.11.2022 diskutierten Feride Funda, Dr. Hanno Hochmuth, Lorenz Maroldt und Lea Streisand in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Die 14 Veranstaltung der Reihe „Zukunftswerkstatt Einheit“ wurde moderiert von Cosima Schmitt.Tue, 01 Nov 2022 - 1h 30min - 1080 - Wir müssen reden! Demokratieverständnis in Ost und West
Thema des zweiten Gesprächs unserer Reihe „Wir müssen reden!“ ist das Demokratieverständnis in Ost- und Westdeutschland: Im Osten Deutschlands haben sowohl die Alternative für Deutschland als auch die Linkspartei ihre größten Wahlerfolge erzielt. Proteste gegen die Corona-Maßnahmen fallen dort in manchen Regionen besonders heftig aus. Lassen sich angesichts zunehmender politischer Polarisierungen sowie der Diktatur- und Transformationserfahrungen im Osten Deutschlands grundlegende Unterschiede zwischen „alten“ und „neuen“ Ländern feststellen? Befindet sich die Demokratie vielleicht sogar in einer Krise? Darüber sprachen am 20.01.2022 Prof. Dr. Wolfgang Merkel und Prof. Dr. Steffen Mau.
Thu, 20 Jan 2022 - 1h 18min - 1079 - 60 Jahre Mauerbau – geteilte(s) Leben | Zeitzeugenperspektiven
Am 13. August 2021 jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 60. Mal. Das historische Ereignis und seine weitreichenden Folgen haben das Leben vieler Menschen in Ost und West geprägt. Die Veranstaltung lässt Zeitzeugen zu Wort kommen, die mit der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer ganz persönliche Umwälzungen verbinden – sei es im Familien- und Freundeskreis, im Beruf oder hinsichtlich ihrer Überzeugungen.
Folgende Fragen werden diskutiert: Welche Zäsur markiert der 13. August 1961 in den Biografien? Wie beeinflussten die innerdeutsche Grenze und die Mauer den Alltag in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland? Was konnte der Einzelne der Mauer entgegensetzen? Und nicht zuletzt soll der Bogen in die Gegenwart geschlagen werden: Welche erinnerungskulturelle Bedeutung kommt der Mauer und der deutschen Teilung heute zu?Tue, 25 May 2021 - 1h 04min - 1078 - Die Gegenwart der Vergangenheit. 30 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion
Jede Gesellschaft, jeder Staat steht nach Gewaltherrschaft, Diktaturen oder Kriegen vor der Frage, wie mit den begangenen Verbrechen, mit den Opfern und Tätern umgegangen werden soll. Die Formen des Umgangs mit der Vergangenheit sind dabei sehr vielfältig. Mysteriöse Anschläge auf Regime-Kritiker, Repressionen gegen Demonstranten und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim kennzeichnen das heutige Russland als einen autoritären Staat und erinnern an die frostigen Zeiten des Kalten Kriegs. Imperiale Großmachtvorstellungen scheinen nicht nur die russische Politik, das Verhältnis zu den Nachbarstaaten Ukraine und Belarus, sondern auch die nostalgischen Sehnsüchte von Teilen der Bevölkerung zu bestimmen – die Vergangenheit ist zur Gegenwart geworden. Welches Bild der Sowjetunion wird im heutigen Russland gezeichnet? Welche Rolle spielt der Stalinismus in der russischen, der ukrainischen und belarussischen Geschichtspolitik? Wie kann an das grausame Lagersystem und das Massenmorden unter Stalins Herrschaft erinnert werden? In welchem Verhältnis steht die Arbeit von NGOs zu den Regierungen in Russland, Belarus und der Ukraine? Diesen und weiteren Fragen widmete sich die sechste Veranstaltung der Reihe Transitional Justice „Die Gegenwart der Vergangenheit – 30 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion“.
Fri, 17 Dec 2021 - 1h 22min - 1077 - 30 Jahre danach – Perspektiven auf den Einigungsprozess | Zeitzeugenperspektiven
In unserer neuen Reihe „Zeitzeugenperspektiven“ diskutierten die Ärztin und Politikerin Dr. Sabine Bergmann-Pohl und der Historiker und Politiker Dr. Stephan Eisel über das Thema „30 Jahre danach – Perspektiven auf den Einigungsprozess“. Bei diesem Gespräch sprachen Frau Dr. Bergmann-Pohl aus ostdeutscher und Herr Dr. Eisel aus westdeutscher Sicht darüber, wie der Weg zur deutschen Einheit und der anschließende Transformationsprozess aus heutiger Sicht betrachtet und bewertet werden kann.
Mon, 07 Dec 2020 - 50min - 1076 - Blitzableiter für Bonn – Die Treuhandanstalt im politischen Einflussbereich der Bundesregierung
Dr. Andreas Malycha vom Institut für Zeitgeschichte München – Berlin spricht über die Spannungen und Kontroversen zwischen der Treuhandanstalt in Berlin und der Bundesregierung in Bonn. Denn die Arbeit der Privatisierungsbehörde agierte niemals losgelöst von staatlichen und politischen Instanzen wie dem Bundesfinanzministerium, dem Bundeswirtschaftsministerium oder dem Bundeskanzleramt. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe "Die überforderte Behörde. Neue Forschungen zur Treuhandanstalt".
Mon, 17 Aug 2020 - 1h 17min - 1075 - „Auf Dauer Frauenpower?“ Frauen und die deutsche Einheit
Frauen hatten in der DDR scheinbar gute Voraussetzungen für ein gleichberechtigtes Leben. Trotzdem berichten viele ostdeutsche Frauen rückblickend davon, wie schwierig es gewesen sei, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Denn das propagierte Frauenbild und die Alltagswirklichkeit klafften in vielen Lebensbereichen weit auseinander. Die Veränderungen im Zuge der deutschen Einheit brachten dann tiefgreifende Umbrüche mit sich, gerade für viele ostdeutsche Frauen und ihre berufliche wie finanzielle Situation. In unserer Veranstaltung wollen wir danach fragen, wie sie den Systemwechsel erlebten und welche Rolle es heute noch für sie spielt, ostdeutsch zu sein. Wo stehen Frauen aus Ost und West heute, wie sieht ihre Lebenswirklichkeit aus? Was haben sie voneinander gelernt? Bei der 13. Veranstaltung der Reihe "Zukunftswerkstatt Einheit" diskutierten unsere Gäste den Alltag von Frauen in Vergangenheit und Gegenwart, geben persönliche Einblicke in ihr Leben und schlagen den Bogen von der Situation damals zu den aktuellen Debatten heute.
Tue, 04 Oct 2022 - 1h 31min - 1074 - Angst schüren statt Vertrauen schaffen: der Umgang des Kremls mit kritischen NGOs
Am 25.11.2021 hat der Gerichtsprozess gegen Memorial International in Moskau begonnen. Angeklagt wegen des Verstoßes gegen das „Gesetz über ausländische Agenten“ von 2012 möchte sich der Kreml der wichtigsten Nichtregierungsorganisation in Russland entledigen. Mit der Offenlegung der historischen Wahrheit über die politischen Repressionen und Verbrechen während des Stalinismus in der Sowjetunion ist sie den Machthabern schon lange ein Dorn im Auge.
Am 14.12. wird der Prozess fortgeführt. Wie bedrohlich die Situation für Memorial in diesem Prozess ist, welche erinnerungspolitischen Motive hinter dem drohenden Verbot stecken und welche langfristigen Folgen es für die Erinnerungskultur und die Menschenrechtssituation in Russland hat, beantworteten die Mitbegründerin von Memorial Moskau Prof. Dr. Irina Scherbakowa und Dr. Anke Giesen (Memorial Deutschland).Wed, 15 Dec 2021 - 1h 26min - 1073 - Städte im Wandel – Transformation auf kommunaler Ebene seit 1990
Der Strukturwandel in Stadt und Land war eine der großen Herausforderungen für die Menschen in Ostdeutschland. Mit dem Inkrafttreten der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion sowie des Einigungsvertrages wurden 1990 vielerorts tiefgreifende Transformationsprozesse in Gang gesetzt. Ostdeutsche Kommunen standen vor der Aufgabe, ihre Verwaltung umzuformen, Infrastruktur zu sanieren, sich wirtschaftlich neu aufzustellen und auf den Bevölkerungswandel zu reagieren.
Unter welchen verwaltungsrechtlichen und politischen Maßgaben vollzogen sich die Veränderungen? Wie haben die Verantwortlichen die Herausforderungen erlebt und welche Unterstützung haben sie erfahren? Inwieweit ist die Entwicklung in Ostdeutschland vergleichbar mit der westdeutscher Kommunen? Welche Chancen wurden ergriffen und welche vertan? Schließlich bleibt zu fragen, was aus dieser Zeit des Strukturwandels bis heute nachwirkt.
Die Veranstaltung thematisierte, wie die deutsche Einheit und die anschließenden Umbrüche in Kommunen gestaltet wurden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Perspektiven von Akteuren und Experten sowie wie die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer.Tue, 26 Oct 2021 - 1h 03min - 1072 - Coming out. Geschlecht und Gesellschaft in der DDR und der Transformationszeit
Der Alltag von Angehörigen homosexueller und anderer geschlechtlicher Minderheiten war in der DDR vielfach von Diskriminierung oder sogar Kriminalisierung geprägt. Das bedeutete für sie eine schwierige Lebensrealität und erhebliche Hürden im offenen Ausleben der eigenen Identität. Diese Menschen fanden im öffentlichen Raum keinen Platz, mussten häufig unter Verunglimpfung und Überwachung leiden. Erst ab den 1980er-Jahren verbesserten sich die öffentlichen Lebensumstände für schwule und lesbische Bürgerinnen und Bürger der DDR. 1988 wurde der Paragraph, der Homosexualität als Straftatbestand verurteilte, im Strafgesetzbuch der DDR endgültig gestrichen. Im vereinten Deutschland blieb er noch bis 1994 bestehen. Andere Identitäten, beispielsweise von Transgender-Personen, finden in der historischen Betrachtung der DDR und Transformationszeit bisher kaum Beachtung.
Die achte Veranstaltung der Reihe „Zukunftswerkstatt Einheit“ stellte die Situation von LGBTQIA*-Minderheiten in der DDR und im Transformationsprozess in den Mittelpunkt. Welche Rolle spielte die Diskriminierung dieser Menschen in der Lebensrealität der DDR, gab es Unterschiede zwischen Ost und West und was für Veränderungen brachte die Transformationszeit für das vereinte Deutschland?Tue, 05 Oct 2021 - 1h 31min - 1071 - Jahrbuch Deutsche Einheit 2021. Buchpremiere
Corona-Krise statt Einheitsjubel – die Probleme der Gegenwart haben die Erinnerung an 30 Jahre Wiedervereinigung fast überdeckt. Aber trotz verbindender Krisenerfahrung wird die Deutsche Einheit als nicht abgeschlossener Prozess wahrgenommen. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Ch. Links Verlag laden zur Premiere des neuen »Jahrbuches Deutsche Einheit« ein. Der zweite Band untersucht das Verhältnis von Einheit und Differenz, von strukturellem Wandel und Erfahrungen nach 1990 auf unterschiedlichen Ebenen.
Die Autorinnen und Autoren Dr. Uta Bretschneider, Dr. Thorsten Holzhauser und Dr. Wiebke Reinert diskutierten mit dem Herausgeber Dr. Marcus Böick unter anderem über die Rolle der PDS im vereinten Deutschland, den Wandel ländlicher und städtischer Lebenswelten in der Vereinigungsgesellschaft und Fragen der Geschichtsvermittlung sowie der Erinnerungskultur.Mon, 20 Sep 2021 - 1h 01min - 1070 - Weinbau in Ostdeutschland – Ist zusammengewachsen, was zusammengehört?
Wie sah der Weinbau vor und nach 1989 in Ostdeutschland aus? Und welche Hürden waren nach der Wiedervereinigung beim Aufbau eines wirtschaftlich rentablen Weinguts zu überwinden? Darüber und über viele anderen spannende Aspekte des Themas diskutierten die Spitzenwinzer Bernard Pawis aus Freyburg und Prinz Georg zur Lippe aus Meißen in unserer Online-Veranstaltung am 03.12.2020.
Thu, 03 Dec 2020 - 50min - 1069 - Fakten – Meinung – Mythen. Die DDR als Projektionsfläche
Gab es im „ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden“ tatsächlich keinen Antisemitismus, keine Kriminalität, keine Wohnungsnot, dafür aber die beste Bildung und medizinische Versorgung für jeden und überall soziale Gerechtigkeit und Solidarität? Darüber diskutierten die ehemalige Grünen-Politikerin Antje Hermenau und der DDR-Bürgerrechtler Werner Schulz in unserer Veranstaltung „Fakten – Meinung – Mythen. Die DDR als Projektionsfläche!“
Fri, 27 Nov 2020 - 1h 18min - 1068 - "Weißt du noch?" Woran wir uns erinnern | Zukunftswerkstatt Einheit
Die dritte Veranstaltung der Reihe „Zukunftswerkstatt Einheit. Hoffnungen – Veränderungen – Perspektiven“ will die Erinnerungskultur nach 30 Jahren deutscher Einheit thematisieren. Wie erinnern sich die Menschen in Deutschland und Ostmitteleuropa heute an das Ende der kommunistischen Diktaturen und die anschließende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation ihrer Länder? Historikerin Carola Rudnick und der Zukunftsforscher Karlheinz Steinmüller sprachen am 04.11.2020 über den Stand der Erinnerungskultur nach 30 Jahren deutscher Einheit.
Tue, 03 Nov 2020 - 59min - 1067 - Generation Einheit - Was teilt Ihr / Euch?
Im 30. Jahr der deutschen Einheit wird eine Generation erwachsen, die im wiedervereinigten Deutschland geboren wurde und aufgewachsen ist. Die Frage, wie viel Einheit die „Generation Einheit“ eigentlich fühlt und lebt, ist häufig überdeckt von diversen tagespolitischen Debatten über die unterschiedlichen Erfahrungen mit der Wiedervereinigung und Transformationszeit. Dahinter stehen grundsätzliche Fragen an die heute 18- bis 30-Jährigen, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen: Was prägt die „Generation Einheit”? Hat sie eine gemeinsame Geschichte? Und wie viel Einheit zeichnet die „Generation Einheit” eigentlich aus?
Tue, 20 Oct 2020 - 1h 42min - 1066 - Nebenregierung Ost? Die Treuhand und die Region Berlin-Brandenburg
War die Treuhand wirklich eine abgeschottete Behörde, auf deren Wirken die neuen Länder kaum Einfluss hatten? Wolf-Rüdiger Knoll vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin sprach am 12.10.2020 im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Die überforderte Behörde. Neue Forschungen zur Treuhandanstalt“ über das ambivalente Verhältnis der Privatisierungsbehörde zur brandenburgischen Landesregierung am Beispiel des Stahlwerks in Eisenhüttenstadt.
Mon, 12 Oct 2020 - 1h 21min - 1065 - Zwischen Befreiung und Beeinflussung -Vom Umgang mit der sowjetischen Besatzung im heutigen Kaukasus
Jede Gesellschaft, jeder Staat steht nach Gewaltherrschaft, Diktaturen oder Kriegen vor der Frage, wie mit den begangenen Verbrechen, mit den Opfern und Tätern umgegangen werden soll. Die Formen des Umgangs mit der Vergangenheit sind dabei sehr vielfältig. Die 10-teilige Veranstaltungsreihe „Transitional Justice“ möchte anhand ausgewählter Länderbeispiele unterschiedliche Aspekte von gesellschaftlichen und rechtlichen Aufarbeitungsprozessen nach Systemumbrüchen aufzeigen sowie Einblicke in die Erinnerungskultur und -politik in ihrem jeweiligen nationalen Kontext geben. Moderiert wird die Reihe von Tamina Kutscher, Chefredakteurin von dekoder.org.
Die fünfte Veranstaltung „Zwischen Befreiung und Beeinflussung – Vom Umgang mit der sowjetischen Besatzung im heutigen Kaukasus“ hat den Fokus auf die Staaten Georgien, Aserbaidschan und Armenien gerückt.Wed, 14 Sep 2022 - 1h 20min - 1064 - Wir müssen reden! Eine Veranstaltung zum Tag der Demokratie 2021
Der 15. September wurde von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag der Demokratie erklärt. Aus diesem Anlass haben wir zu zwei Diskussionsrunden über aktuelle Fragen zum Zustand der Demokratie eingeladen. Diskussionsthemen waren »Demokratie – ein Generationenprojekt? Oder wofür es sich zu kämpfen lohnt.« und »Leben wir in einer ‚DDR 2.0‘?«
Wed, 15 Sep 2021 - 1h 02min - 1063 - Zukunft gestalten, Natur erhalten. Natur- und Umweltschutz in Ostdeutschland
Die unabhängige Umweltbewegung war eine wichtige Keimzelle der Opposition gegen das SED-Regime. Viele Menschen protestierten gegen die wachsende Zerstörung der Natur und die Gefährdung ökologischer Grundlagen in der DDR. Die Bürgerinnen und Bürger forderten einen nachhaltigen Umweltschutz. So spielte dieses Thema später auch eine bedeutende Rolle in und nach der Friedlichen Revolution. Mit dem Vereinigungs- und Transformationsprozess seit den 1990er-Jahren setzte ein sensiblerer Umgang mit der zerstörten Umwelt ein. Zahlreiche Schutzmaßnahmen wurden in Ostdeutschland initiiert. Dennoch sind die Folgen jahrzehntelanger Industriepolitik bis heute spürbar. Die siebte Veranstaltung der Reihe „Zukunftswerkstatt Einheit“ widmete sich dem Natur- und Umweltschutz im Osten Deutschlands im Verlauf der letzten 30 Jahre. Welche Entwicklungen und Veränderungen lassen sich nachzeichnen und welche Auswirkungen sind bis heute spürbar? Welche Bezüge gibt es zu gegenwärtigen Umweltprotesten?
Tue, 07 Sep 2021 - 1h 34min - 1062 - Migrantische Erfahrungen im vereinten Deutschland | Zukunftswerkstatt Einheit
Die zweite Veranstaltung der Reihe „Zukunftswerkstatt Einheit. Hoffnungen – Veränderungen – Perspektiven“ möchte die Erlebnisse von Migrantinnen und Migranten nach 30 Jahren deutscher Einheit thematisieren. Welche Bedeutung hatte die Vereinigung beider deutscher Staaten für sie? Welche Erfahrungen machten sie während des Transformationsprozesses seit Anfang der 1990er-Jahre? rbb-Moderatorin Dilek Üşük sprach am 09.10.2020 mit Ferda Ataman, Hareth Almukdad und Prof. Barbara John über die bislang wenig beachteten Perspektiven der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter im Westen sowie der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter im Osten.
Fri, 09 Oct 2020 - 1h 34min - 1061 - Die Treuhand und der Fall Carl Zeiss Jena
Die Aufgabe, das Verhältnis zwischen Carl Zeiss Jena und seinem Westpendant Carl Zeiss Oberkochen zu klären und die Unternehmen gegebenenfalls zusammenzuführen war auch sinnbildlich für die staatliche Wiedervereinigung von Bundesrepublik und DDR. Prof. Dr. André Steiner vom Leibniz Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam spach im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Die überforderte Behörde. Neue Forschungen zur Treuhandanstalt“ über die Interessen und Positionen der einzelnen Akteure in diesem Prozess und die daraus resultierenden Schwierigkeiten.
Mon, 28 Sep 2020 - 1h 19min - 1060 - Wie steht’s um die Einheit? Premiere des neuen Jahrbuchs Deutsche Einheit
Erfolg oder Scheitern, Modernisierung oder Kolonisierung, blühende Landschaften oder Dunkeldeutschland – die Geschichte der deutschen Einheit ist auch eine Geschichte dieser kontroversen Interpretation. Darüber diskutierte die Moderatorin Anja Maier am 25. September 2020 mit Dr. Marcus Böick, Prof. Dr. Constantin Goschler und Prof. Dr. Ralph Jessen. Sie sind die Herausgeber des neuen „Jahrbuch Deutsche Einheit“.
Fri, 25 Sep 2020 - 1h 19min - 1059 - Helden und Halunken? Die Treuhandanstalt und ihr Personal
Dr. Marcus Böick von der Ruhr-Universität Bochum spricht in einem Vortrag im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Die überforderte Behörde. Neue Forschungen zur Treuhandanstalt“ über das besonders umstrittene Personal der Treuhand, welches häufig in Verbindung mit den Konflikten bei der Privatisierungspraxis der frühen 1990er-Jahre steht. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe "Die überforderte Behörde. Neue Forschungen zur Treuhandanstalt".
Mon, 14 Sep 2020 - 1h 33min - 1058 - Markus Meckel: „Zu wandeln die Zeiten“
Markus Meckel war eine der zentralen Figuren der Oppositionsbewegung in der DDR, Akteur der Friedlichen Revolution von 1989 und Gestalter des Prozesses zur deutschen Einheit. Der langjährige Bundestagsabgeordnete und Außenpolitiker engagiert sich bis heute aktiv für eine europäisch orientierte Erinnerungskultur und die Aufarbeitung der Diktaturen des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt als Ratsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Am 10. September 2020 stellte er sein Buch „Zu wandeln die Zeiten“ in der Bundesstiftung Aufarbeitung vor, gemeinsam im Gespräch mit Klara Geywitz, Nikolaus Schneider und Jörg von Bilavsky.
Thu, 10 Sep 2020 - 1h 32min - 1057 - Landnahme? Ostdeutsche Dörfer im Wandel | Zukunftswerkstatt Einheit
In der ersten Veranstaltung userer Reihe „Zukunftswerkstatt Einheit. Hoffnungen – Veränderungen – Perspektiven“ diskutierte Inforadio rbb-Moderator Harald Asel am 08.09.2020 mit Dr. Jens Schöne, Dr. Uta Bretschneider, Detlef Kurreck und Reiko Wöllert über die Transformation der ostdeutschen Landwirtschaft nach 1989/90 und über die Spuren, die die DDR im ländlichen Raum hinterlassen hat.
Tue, 08 Sep 2020 - 1h 30min - 1056 - Das unzufriedene Volk. Protest und Ressentiment in Ostdeutschland seit 1989/90
Der Religions- und Kultursoziologe Detlef Pollack spricht bei der Präsentation seines Buchs „Das unzufriedene Volk“ über die Geschichte des Protests und des Ressentiments in Ostdeutschland seit der Friedlichen Revolution und diskutiert anschließend mit Franziska Kuschel und Ulrich Mählert von der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Wed, 02 Sep 2020 - 1h 17min - 1055 - Privatisierung international: Fallstudien zu deutsch-tschechischen Joint Ventures
Dr. Eva Schäffler vom Institut für Zeitgeschichte München – Berlin spricht über wirtschaftliche Transformationsprozesse und Privatisierungspolitik am Beispiel der Tschechischen Republik. Kooperationen mit deutschen Unternehmen spielten dabei eine wichtige Rolle, wie der Vortrag anhand der Beispiele Škoda und Volkswagen sowie Barum und Continental zeigt. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe "Die überforderte Behörde. Neue Forschungen zur Treuhandanstalt".
Mon, 31 Aug 2020 - 1h 21min - 1054 - Die Menschen und die Mauer - Zeitzeugengespräch zum 60. Jahrestag des Mauerbaus
Am 13. August vor 60 Jahren riegelte die Staatsführung der DDR die damals noch durchlässige Grenze zu West-Berlin ab und machte Millionen Menschen in der DDR zu Gefangenen im eigenen Land. Über Jahre blieben Familien und Freunde getrennt. Hunderte kamen an der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer ums Leben. Nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 wurde die Mauer über Nacht aus einem Symbol der Teilung und des menschenverachtenden kommunistischen Regimes in der DDR zu einem Symbol der Freiheit. Inzwischen erinnern Mauerdenkmäler in der ganzen Welt an die Zeit der deutschen Teilung, den Kalten Krieg und die kommunistische Herrschaft und ihre vielen Opfer.
Aus diesem Anlass haben wir am 9. August 2021 Zeitzeugen zu Wort kommen lassen und ihre Erinnerungen und Erfahrungen an den Mauerbau und die Folgen für die Menschen in Ost und West geteilt: Wie erinnern sie sich an den Tag des Mauerbaus? Wie lebten sie in der geteilten Stadt im unmittelbaren Grenzgebiet? Und wie blicken sie heute auf diese Zeit? Und wie sehen sie das Verschwinden der Mauer aus dem Stadtbild in Berlin und ihr Wiedererstehen als Denkmäler in anderen Ländern?Mon, 09 Aug 2021 - 1h 38min - 1053 - Hass oder Versöhnung? Nationale Identität und transnationale Beziehungen auf dem Balkan
Jede Gesellschaft, jeder Staat steht nach Gewaltherrschaft, Diktaturen oder Kriegen vor der Frage, wie mit den begangenen Verbrechen, mit den Opfern und Tätern umgegangen werden soll. Die Formen des Umgangs mit der Vergangenheit sind dabei sehr vielfältig. Die 10-teilige Veranstaltungsreihe „Transitional Justice“ möchte anhand ausgewählter Länderbeispiele unterschiedliche Aspekte von gesellschaftlichen und rechtlichen Aufarbeitungsprozessen nach Systemumbrüchen aufzeigen sowie Einblicke in die Erinnerungskultur und -politik in ihrem jeweiligen nationalen Kontext geben. Moderiert wird die Reihe von Tamina Kutscher, Chefredakteurin von dekoder.org. Die vierte Veranstaltung der Reihe "Transitional Justice“ hat den Fokus auf die Prozesse der Transitional Justice in Albanien, Rumänien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina gerückt.
Tue, 22 Jun 2021 - 1h 49min - 1052 - Transformation im Bildungswesen seit 1989/90
Die zweite Veranstaltung der Reihe "Zeitzeugenperspektiven" thematisierte die Transformationsprozesse im Bildungswesen seit 1989/90. Im Mittelpunkt standen die Perspektiven von Zeitzeugen, die diese Umbrüche in Politik, Verwaltung und Bildungseinrichtungen miterlebt und -gestaltet haben. Welche Voraussetzungen brachten die Bildungssysteme der DDR und der Bundesrepublik Deutschland mit und welche Ideen wurden am „Runden Tisch“ entwickelt und in den Einigungsvertrag einbezogen? Wie verlief die Umgestaltung in bestimmten Bereichen, etwa im Schulwesen? Welche inhaltlichen und personellen Veränderungen und Kontinuitäten gab es?
Tue, 15 Jun 2021 - 1h 13min - 1051 - „Auf Jahre unschlagbar“ Der Weg zu einer gesamtdeutschen Sportnation
Vor dem gesamtdeutschen Sport schien 1990 eine goldene Zukunft zu liegen. Die Rechnung war einfach: Aus zwei erfolgreichen Sportländern sollte nun eine noch bessere, eine fast »unschlagbare« werden, wenn sich die Medaillen Ost und West zu neuen gesamtdeutschen Erfolgen summieren würden. Dafür mussten zwei grundverschiedene Sportsysteme zusammenwachsen. Der Staatssport DDR, der eine wichtige gesellschaftspolitische Funktion zu erfüllen hatte, prallte dabei auf ein ganz anderes Prinzip des organisierten Sports in der Bundesrepublik. Während auf organisatorischer Ebene rasch gemeinsame Wege beschritten wurden, konnten in den zurückliegenden 30 Jahren nicht alle optimistischen Erwartungen an sportliche Triumphe erfüllt werden. Die vierte Veranstaltung der Reihe »Zukunftswerkstatt Einheit. Hoffnungen – Veränderungen – Perspektiven« hat die Entwicklungen des gesamtdeutschen Sportbetriebs seit 1990 in den Blick genommen.
Tue, 01 Jun 2021 - 1h 01min - 1050 - Erinnern an zwei Diktaturen? Aufarbeitungskonkurrenz im Baltikum
Mit der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes am 23. August 1939 wurden die drei baltischen Staaten dem sowjetischen Machtbereich zugeordnet, durch die Rote Armee besetzt und bis 1990 der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken einverleibt. Die sowjetische Besatzung wurde von 1941 bis 1944 unterbrochen durch die nationalsozialistische deutsche Besatzung. Die Region wurde zum Schauplatz von brutaler Willkür, Gewalttaten, Massenverhaftungen, Massenliquidationen und Deportationen. Wie gehen die heutigen baltischen Staaten mit dieser doppelten Diktaturgeschichte um und welche Ansätze der Transitional Justice gab es nach der wiedererlangten Unabhängigkeit 1990 in diesen Staaten? Kann man von einer Aufarbeitungskonkurrenz sprechen? Diesen und weiteren Fragen widmete sich die dritte Veranstaltung der Reihe "Transitional Justice"
Tue, 11 May 2021 - 1h 15min - 1049 - Ankunft im Alltag. Künstler im vereinigten Deutschland
Mit der deutschen Einheit kam es zu einem grundlegenden Wandel der kulturellen Infrastruktur in Ost und West. Dieser ging mit gravierenden Veränderungen für die Künstlerinnen und Künstler einher. Die Erfahrungen mit der Vereinigung zweier verschiedener Kulturlandschaften und die Veränderungen des deutschen Kulturbetriebs nach 30 Jahren Einheit sind für den Einzelnen sehr unterschiedlich und geben Anlass zu vielen Fragen. Wie veränderte sich das Schaffen für die Akteurinnen und Akteure seit der Einheit? Wie wurden und werden die Revolutions- und Transformationserfahrungen in Kunst und Kultur verarbeitet? Und wie vereint ist die Kunst- und Kulturszene heute?
Die fünfte Veranstaltung der Reihe »Zukunftswerkstatt Einheit« hat die Entwicklung eines gesamtdeutschen Kulturbetriebs nach 30 Jahren deutscher Einheit thematisiert, das Spannungsfeld zwischen Ost und West vermessen und nicht zuletzt nach dem Gewicht der Kultur in Politik und Gesellschaft gefragt.Tue, 04 May 2021 - 1h 34min - 1048 - Treuhand: Fakten – Meinung – Mythen
Die Arbeit der Treuhandanstalt polarisiert bis heute. Ihre Arbeit wurde von Beginn an kontrovers diskutiert und es war strittig, welche Ausrichtung die Behörde haben sollte, der rund 8.500 ehemals „volkseigene Betriebe“ der DDR mit mehr als vier Millionen Beschäftigten unterstanden. Anlässlich des 30. Jahrestags der Ermordung des Treuhand-Präsidenten Detlev Karsten Rohwedder am 1. April 1991 – dem traurigen Höhepunkt der Auseinandersetzung – sowie der Wahl Birgit Breuels zur neuen Präsidentin am 13. April mit der folgenden Neuausrichtung der Treuhandarbeit haben wir Politik und Zeitzeugen ins Gespräch gebracht. Was steckte hinter der Idee der Ur-Treuhand? Wie alternativlos waren die Richtungsentscheidungen beim Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft 1990/1991? Und welche Folgen der Treuhandarbeit sind bis heute noch spürbar?
Thu, 15 Apr 2021 - 1h 23min - 1047 - Abgehängte Länder. Wie verlassen ist der Osten?
Der Osten Deutschlands steht heute zwischen dem massiven Bevölkerungsverlust in ländlichen Gebieten sowie einem zunehmenden Aufbruch und Attraktivitätsgewinn der Ballungszentren um Leipzig, Dresden oder Berlin. Während die Städte auf den steten Zuwachs reagieren müssen, kämpfen die ländlichen Kommunen gegen die Auswirkungen der Abwanderung der jüngeren Genera-tionen, die damit einhergehende Überalterung und die strukturelle Versorgungsproblematik. Häufig werden die Ursachen dafür in den Folgen der DDR-Zeit gesucht. Doch auch in ländlichen und strukturschwachen Regionen im Westen Deutschlands lassen sich mittlerweile ähnliche Entwicklungen wahrnehmen. Die erste Veranstaltung der Reihe »Zukunftswerkstatt Einheit« im Jahr 2021 hat die demographischen Nachwirkungen des Transformationsprozesses im vereinigten Deutschland untersuchen.
Tue, 06 Apr 2021 - 58min - 1046 - Versöhnung, Gerechtigkeit, Aufarbeitung. Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in Deutschland
ede Gesellschaft, jeder Staat steht nach Gewaltherrschaft, Diktaturen oder Kriegen vor der Frage, wie mit den begangenen Verbrechen, mit den Opfern und Tätern umgegangen werden soll. Die Formen des Umgangs mit der Vergangenheit sind dabei sehr vielfältig. Die zehnteilige Veranstaltungsreihe „Transitional Justice“ möchte anhand ausgewählter Länderbeispiele unterschiedliche Aspekte von gesellschaftlichen und rechtlichen Aufarbeitungsprozessen nach Systemumbrüchen aufzeigen sowie Einblicke in die Erinnerungskultur und -politik in ihrem jeweiligen nationalen Kontext geben. Moderiert wird die Reihe von Tamina Kutscher, Chefredakteurin von dekoder.org. Die Auftaktveranstaltung „Versöhnung, Gerechtigkeit, Aufarbeitung – Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in Deutschland“ rückte vornehmlich den Fokus auf die Aufarbeitungsprozesse in Deutschland.
Tue, 23 Feb 2021 - 1h 03min - 1045 - Gut zu wissen. Das Bildungssystem im Umbruch
Der »PISA-Schock« stieß in Deutschland eine intensive Diskussion über die Qualität des Bildungssystems an und führte zu mehreren tiefgreifenden Schulreformen. Innerhalb der Debatte wird bis heute im Osten zum Teil auch die DDR-Einheitsschule als Vorbild herangezogen. Als richtungsweisend gelten oft ihr Leistungsprinzip, das einheitliche und gemeinsame Lernen über viele Jahre hinweg und ihr naturwissenschaftlicher Fokus. Andere Ausprägungen des SED-Erziehungssystems, über ideologische Indoktrination und politische Reglementierung hinaus, bleiben dabei allerdings oft unterbelichtet. Dies gilt etwa für die Konzentration auf starre Lehrpläne, formalisierte Unterrichtsmethoden oder fehlende Individualität für Lehrende und Lernende. Inwiefern kann also das Bildungssystem der DDR als Referenzrahmen für eine zukunftsorientierte Bildung dienen – und was überhaupt kennzeichnet eine solche? Wie wirkt es bis heute in der ostdeutschen Bildungslandschaft und bei den Menschen nach? Und welche Erfahrungen beim Umbau des Schulwesens nach 1989/90 in den ostdeutschen Bundesländern können auch für gegenwärtige Herausforderung in der Bildung produktiv genutzt werden? Diese und andere Fragen diskutierten unsere Gäste in der elften Veranstaltung der Reihe "Zukunftswerkstatt Einheit".
Tue, 07 Jun 2022 - 1h 31min - 1044 - Journalistische Erfahrungen in Ostdeutschland vor und nach 1989/90
Die journalistische Arbeit in Ostdeutschland war während und nach der deutschen Teilung von ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen geprägt. Ab 1989/90 löste sich die bis dato fundamentale Unterscheidung zwischen DDR-Journalisten und akkreditierten Journalisten aus der Bundesrepublik allmählich auf. Die Veranstaltung widmete sich diesem Thema anhand folgender Fragestellungen: Unter welchen Voraussetzungen haben DDR-Journalisten gearbeitet? Inwieweit mussten sie sich anpassen oder waren Repressionen und Zensur ausgesetzt? Gab es Nischen, in denen Journalisten freier berichten konnten? Welche Erfahrungen haben westdeutsche Journalisten gemacht, die in der DDR akkreditiert waren? Wie wandelte sich der Journalismus in Ostdeutschland nach 1989/90? Bei der fünften Veranstaltung der Reihe "Zeitzeugenperspektiven" wurden Zeitzeugen zugeschaltet, die selbst in Presse und Fernsehen tätig waren. Eine medienwissenschaftliche Perspektive auf den deutsch-deutschen Journalismus ergänzt die autobiografischen Berichte.
Thu, 02 Jun 2022 - 1h 06min - 1043 - Verpasste Chance? Die Repräsentation von Ostdeutschen in Führungspositionen seit 1990
Die Bundestagswahl und die Debatte um die Besetzung von Führungspositionen in der neuen Bundesregierung machten erneut deutlich, was wissenschaftliche Studien seit Jahren zeigen: Ostdeutsche sind auch nach mehr als 30 Jahren nach der Wiedervereinigung in bestimmten Bereichen von Politik, Wirtschaft und Verwaltung unterrepräsentiert. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Politik, Medien und Wissenschaft diskutierten wir die historischen Ursachen wie auch die Folgen des Elitenwechsels. Warum ist es für Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern noch immer schwierig, in Spitzenpositionen zu kommen? Welche Erfahrungen machten und machen sie auf dem Arbeitsmarkt?
Thu, 12 May 2022 - 1h 25min - 1042 - Vereint versorgt. Das gesamtdeutsche Gesundheitssystem seit 1989/90
Die Entwicklung des Gesundheitswesens in Ostdeutschland ist beispielhaft für jene Transformationsprozesse, die am wenigsten geradlinig verliefen. Zunächst nach westdeutschem Muster umstrukturiert, kamen nach und nach auch Ausprägungen des überlieferten Gesundheitssystems wieder stärker zurück, etwa das Konzept der kooperativ strukturierten Polikliniken, das sich inzwischen sogar im gesamtdeutschen Gesundheitssystem etabliert hat. Zudem ist das Gesundheitswesen insofern ein Beispiel für den sich immer stärkeren auswirkenden allgemeinen Strukturwandel, als sich disparate Entwicklungen weniger zwischen Ost und West als vielmehr zwischen Stadt und Land vollziehen. Vor welchen Herausforderungen stand das Gesundheitssystem in den zurückliegenden Jahrzehnten und wie wurden sie bewältigt? Welche Herausforderungen warten in Gegenwart und Zukunft – und welche Erkenntnisse hält die Rückschau auf die jüngere Vergangenheit bereit? Diese und andere Fragen wurden bei der zehnten Veranstaltung der Reihe "Zukunftswerkstatt Einheit" diskutiert.
Tue, 03 May 2022 - 1h 28min - 1041 - Kann das weg? Das städtebauliche Erbe der DDR
Nach der deutschen Einheit sahen sich viele ostdeutschen Städte und Gemeinden mit den baulichen Altlasten der sozialistischen Urbanisierung konfrontiert. Vereinzelte Standorte waren aufgrund ihrer Bedeutungssymbolik in der DDR stark gefördert und zu sozialistischen Vorzeige- bzw. Musterstädten aufgebaut (z.B. Karl-Marx-Stadt, Schwedt, Eisenhüttenstadt, Ost-Berlin), andere Orte und Regionen dagegen vernachlässigt worden. Wie gingen die Transformationsgesellschaften nach dem Systembruch mit dem „Erbe der sozialistischen Stadt“ um? Wie ist die Entwicklung rückblickend und heute zu bewerten? Und welche Lehren lassen sich aus über 30 Jahren deutscher Einheit für urbane Entwicklungen in Gegenwart und Zukunft ziehen? In der neunten Veranstaltung der Reihe "Zukunftswerkstatt Einheit" wurden die wesentlichen Ausgangsbedingungen sowie zentralen Entwicklungslinien der nunmehr über 30-jährigen städtebaulichen Transformationsgeschichte untersucht und die gegenwärtigen bzw. zukünftigen Herausforderungen erörtert.
Tue, 05 Apr 2022 - 1h 30min - 1040 - Aus aktuellem Anlass: Neues vom „großen Bruder“? (K)eine Buchvorstellung
„Neues vom ´großen Bruder`“ - unter diesem Titel sollte am 24. Februar, um 16 Uhr, ein neuer Sammelband zum Verhältnis von KGB und MfS vorgestellt werden. Angesichts des Einmarschs Russlands in der Ukraine hat der Veranstaltungstitel eine erschreckende Aktualität bekommen, die sich auch in den Themen unserer Gesprächsrunde mit der Moskauer Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa, dem Osteuropahistoriker Jan C. Behrends und dem Geheimdienstspezialisten Douglas Selvage widerspiegeln wird.
Thu, 24 Feb 2022 - 1h 03min - 1039 - Umkämpfte Arenen – Berliner Stadien im Wettstreit der Erinnerungskulturen
Die Zukunft von Berlins Stadien ist umstritten: Muss das Olympiagelände – Ort der Spiele von 1936 - „entnazifiziert“ werden? Benötigen der Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark, ehemalige Heimstatt des BFC Dynamo, und das Sportforum Hohenschönhausen eine historische Kommentierung? Die 4. Veranstaltung der Reihe "Im Lauf durch die Epochen: Sport und Systemwechsel im 20. Jahrhundert" hat nach der Rolle Berliner Stadien in Demokratie und Diktatur und ihrer heutigen erinnerungskulturellen Symbolkraft gefragt.
Thu, 29 Sep 2022 - 1h 39min - 1038 - Die unbekannten Politikverhandler im Umbruch Europas
Die Staatssekretäre der letzten DDR-Regierung sind in Öffentlichkeit und Geschichtswissenschaften kaum als Akteure des politischen Transformations- und Vereinigungsprozesses der DDR 1990 bewusst. Es gibt weder schriftliche Quellensammlungen noch systematische Zeitzeugeninterviews, die die politische Aufgabe und die biographisch geprägten Expertisen dieser letzten DDR-Staatssekretäre in den Blick nehmen. Dabei sind sie wichtige Zeitzeugen der friedlichen und demokratischen Transformation der DDR. Als Experten wussten sie in ihren jeweiligen Bereichen bestens über vorhandene Defizite, Probleme und Herausforderungen Bescheid – und auch über bis dahin von der SED-Diktatur unter Verschluss gehaltene Akten.
In der Veranstaltung wurden Ausschnitte aus kürzlich aufgenommenen Zeitzeugeninterviews, die mit Staatssekretären und Staatssekretärinnen der letzten DDR-Regierung geführt wurden, gezeigt und auf dem Podium mit drei Staatssekretären vertieft.Mon, 26 Sep 2022 - 1h 46min - 1037 - Jahrbuch Deutsche Einheit 2022
Die Folgen des politischen Umbruchs von 1989/90 wurden bislang vor allem mit Blick auf die Länder hinter dem einstigen Eisernen Vorhang untersucht. In gewisser Weise verlängert die zeithistorische Forschung damit jene Perspektive, die in den 1990er Jahren dazu führte, dass Transformation als einseitige Angleichung an den Westen verstanden wurde. Demgegenüber brachte Philipp Ther den Begriff der Kotransformation ins Spiel, um die vielfältigen Interaktionen und Rückwirkungen zwischen den postkommunistischen Umbruchprozessen in Osteuropa und dem vermeintlich stabilen Westen zu thematisieren. Der »Triumph« westlicher Ideen, liberaler Demokratie und kapitalistischer Marktwirtschaft erscheint auf diese Weise nicht mehr als ungebremster Siegeszug von West nach Ost, sondern als eine krisenhafte und widersprüchliche Beziehungsgeschichte mit offenem Ausgang.
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Ch. Links Verlag haben am 21.09.2022 zur Premiere des neuen »Jahrbuches Deutsche Einheit« eingeladen. Der dritte Band versammelt neben den konzeptionellen Überlegungen Philipp Thers zur Kotransformation erstmals empirische Fallstudien zur Kotransformation des Westens und richtet damit den Blick auch auf die Folgen des deutschdeutschen Vereinigungsprozesses für die Regionen der alten Bundesrepublik.Wed, 21 Sep 2022 - 1h 27min - 1036 - Tag der Demokratie 2022: Wir müssen reden!
Viele Debatten der vergangenen Jahre zeichnen sich durch Zuspitzungen und vermehrt extreme Meinungsäußerungen aus. Beklagt wird von vielen ein zunehmend aggressives Gesprächsklima, das den Austausch kontroverser Ansichten und Argumente verhindert. Sei es bei der Corona-Politik, der Flüchtlingskrise, dem Klimawandel oder Fragen von Identität und sozialer Gerechtigkeit: Wird unsere Gesellschaft tatsächlich immer gespaltener und die Standpunkte unversöhnlicher? Die Bundesstiftung Aufarbeitung hat den Internationalen Tag der Demokratie genutzt, um über Fragen von demokratischer Teilhabe und Diskussionskultur zu reden. Welchen Einfluss haben die beobachteten Entwicklungen auf die Gestaltung von Politik, welche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft?
Thu, 15 Sep 2022 - 1h 09min - 1035 - Glaube verbindet? Religion im Wandel
Zwar trug der Marxismus-Leninismus durchaus Züge einer politischen Religion, indes vermochte die Staatsideologie der DDR die Bedeutung von Religion(en) und Glauben nicht vollständig zu verdrängen. Nach der Friedlichen Revolution hatte der Marxismus-Leninismus als Mittel des Machterhalts und der Herrschaftslegitimation ausgedient, und trotzdem trug der Systembruch kaum zum Bedeutungsgewinn von Religion und Glauben bei. Bis heute sind die ostdeutschen Bundesländer säkularisierter als die westdeutschen – wenngleich die überweltlichen Religionen auch im Westen Deutschlands an Bedeutung verlieren. Doch was an der ostdeutschen Entwicklung lässt sich als Vorläufer der westdeutschen interpretieren – und was als (zum Teil historisch bedingte) Geschichte eigener Art? Diese und andere Fragen wurden in der zwölften Veranstaltung der Reihe „Zukunftswerkstatt Einheit“ diskutiert.
Tue, 06 Sep 2022 - 1h 33min - 1034 - Braune Landschaften. Kontinuitäten von Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland im Spiegel deutscher Teilung und Einheit
2022 jähren sich zwei Ereignisse zum 30. Mal: das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen, als Rechtsextreme Ende August 1992 Geflüchtete und vietnamesische Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter terrorisierten und deren Wohnblock anzündeten, sowie der Anschlag auf zwei von türkeistämmigen Familien bewohnte Häuser in Mölln im November 1992, bei dem drei Menschen starben und neun schwer verletzt wurden. Die Angriffe reihten sich ein in die Welle von gewaltsamen Ausschreitungen und brutalen Übergriffen auf Menschen vor allem mit Migrationsgeschichte, die in den 1990er-Jahren das junge vereinte Deutschland erschütterte. Nur allzu oft geschahen die Taten unter stillschweigender Duldung bis hin zum aktiven Mittun politisch sonst eher unauffälliger Bürgerinnen und Bürger.
Aus Anlass dieser Jahrestage, aber auch vor dem Hintergrund der rassistischen und rechtsextremen Anschläge in Halle 2019 und Hanau 2020 als jüngste Beispiele für die andauernde Gewalt gegen als nicht-zugehörig markierte Personen haben wir am 18. August 2022 in ost-west-übergreifender Perspektive diskutiert.Thu, 18 Aug 2022 - 1h 48min - 1033 - Gegen alle Mauern – Unangepasste Jugendliche in der DDR der 1970er und 1980er Jahre
Der Anpassungsdruck, der auf der Jugend in der SED-Diktatur lastete, war gewaltig. Jugendliche, die sich den Vorschriften und Einengungen ihres Lebens durch die Staatsorgane in Schule, Beruf und Freizeit widersetzten, die sich frei machen und eigene Lebensformen erproben wollten, stießen schnell und hart an die sichtbaren und unsichtbaren Mauern der DDR. Aufgrund ihres „Anderseins“ als Punks oder Friedensaktivistinnen bekamen sie die geballte Macht des Systems zu spüren. Die Auswirkungen auf ihre Jugend und ihre Zukunft waren gravierend: Ausgrenzung von Bildung und Beruf, Stigmatisierung, Verfolgung durch die Stasi und politische Haft.
Wed, 22 Jun 2022 - 1h 14min - 1032 - Sozialpolitik in der Transformation: Der Sozialstaat seit der Wiedervereinigung
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik ist das mit Abstand größte Politikfeld im Bundeshaushalt. Gleichzeitig ist der Sozialstaat elementar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Seit der deutschen Einheit ist das Sozialsystem in beständiger Transformation, die in Teilen auch auf das Ende der Systemauseinandersetzung im Kalten Krieg zurückgeht. Seit 1990 haben grundlegende Erweiterungen und Veränderungen des deutschen Sozialstaats stattgefunden: von der Schaffung der Pflegeversicherung über die Hartz-Gesetzgebung bis hin zur Einführung eines Bürgergeldes. Die Podiumsdiskussion hat aus politischer und wissenschaftlicher Perspektive ein Resümee der sozialstaatlichen Entwicklung seit 1990 gezogen und ist dabei auch auf gegenwärtige sozialpolitische Herausforderungen eingegangen.
Wed, 08 Jun 2022 - 1h 42min - 1031 - Aufarbeitung ohne Ende! Bilanz, Herausforderungen, Perspektiven
Was hat Transitional Justice in den vergangenen Jahren weltweit erreicht? Vor welchen Herausforderungen steht sie angesichts aktueller politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen? Was ist entscheidend für die Zukunft der Aufarbeitung? Diesen Fragen widmet sich die Abschlussveranstaltung der Reihe „Transitional Justice“, die in neun Veranstaltungen den Status quo der Aufarbeitung in verschiedenen Ländern aus aller Welt erörterte. Die zehnte und letzte Veranstaltung „Aufarbeitung ohne Ende!“ beleuchtete das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln – wie etwa der Versöhnung, der Menschenrechte und der Erinnerungskultur – und möchte auf diese Weise die Erfolge wie Misserfolge der Aufarbeitung bilanzieren, für die Bedeutung und Vielfalt der zu bewältigen Herausforderungen im Umgang mit der Vergangenheit sensibilisieren und Perspektiven für die zukünftige Arbeit skizzieren.
Tue, 24 May 2022 - 1h 42min - 1030 - Körper-Kriege: Diskriminierung und Optimierungszwang im Spitzensport
Athletinnen waren stets besonders vulnerabel: sie waren Objekt pharmakologischer Eingriffe, oder wurden als sowjetische Kampfmaschinen diffamiert. Angehörigen des dritten Geschlechts wurde Betrug unterstellt. Seit Mitte der 1960er Jahre mussten sich Athletinnen im männlich regierten Sport demütigenden „Sex-Tests“ unterziehen. Die zweite Veranstaltung der Reihe "Im Lauf durch die Epochen: Sport und Systemwechsel im 20. Jahrhundert" fragt danach, welche Kämpfe bis heute um die Selbstbestimmung des sportlichen Körpers geführt werden.
Thu, 19 May 2022 - 1h 18min - 1029 - Im Laboratorium der Marktwirtschaft. Neue Forschungen zur Geschichte der Treuhandanstalt
Die Arbeit der Treuhandanstalt ist hoch umstritten – wie sieht das Gesamtbild nach der Öffnung der Treuhandakten aus? Erstmals konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts für Zeitgeschichte München–Berlin (IfZ) etwa 12 Kilometer Treuhandakten systematisch auswerten und zudem viele andere neue Quellen erschließen. Die Ergebnisse dieser intensiven Forschungen werden seit April 2022 in der elf Bände umfassenden Reihe „Studien zur Geschichte der Treuhandanstalt“ im Verlag Ch. Links veröffentlicht. Nie zuvor wurde die Treuhandanstalt so umfangreich in den Blick genommen.I m Gespräch mit Anne Hähnig (Die Zeit) stellten die Historiker Max Trecker und Andreas Malycha die ersten Publikationen der neuen Studien vor.
Wed, 27 Apr 2022 - 1h 35min - 1028 - Geschichte als Waffe. Historischer Neoimperialismus unter Putin und seine Folgen für Europa
Am 24. Februar 2022 haben russische Streitkräfte die Ukraine überfallen. Tausende Menschen haben bisher ihr Leben verloren, Millionen sind auf der Flucht – Städte werden gnadenlos bombardiert und Angriffe gegen zivile Einrichtungen und die Bevölkerung gerichtet. Städte wie Charkiv oder Mariupol werden belagert, ausgehungert und dem Erdboden gleichgemacht.
Der Krieg gegen die Ukraine wird von der russischen Regierung und Propaganda mit historischen Legitimationen versehen, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion als überholt, ja überwunden, galten. Der Versuch der russischen Führung gewaltsam als imperiale Großmacht wieder in die Mitte des europäischen Kontinents zurückzukehren, ist die wohl größte Gefahr für die europäische Sicherheit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Zentrum der Veranstaltung stehen deshalb Geschichtsnarrative, die von Putin zur Begründung seines Überfalls auf die Ukraine sowie zur Begründung von Territorialansprüchen gegenüber weiteren Staaten angeführt werden.Tue, 26 Apr 2022 - 2h 01min - 1027 - Geteilte Erinnerung: Das kurze Leben des Philipp Müller
Vor 70 Jahren: Essen am 11. Mai 1952. Trotz Verbot durch die Behörden versammeln sich Tausende zumeist junge Demonstranten in der Ruhr-Metropole. Sie protestieren gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Es ist die Hochzeit des Kalten Krieges. Als Mitinitiator der Kundgebung gilt der westdeutsche Ableger der SED-Jugendorganisation FDJ. Die war im Jahr zuvor von der Bundesregierung als verfassungsfeindliche Organisation verboten worden. Die Demonstranten ignorieren die Aufforderung der Polizei, sich zu zerstreuen. Es kommt zum Schlagstockeinsatz. Demonstranten antworten mit Stein- und Flaschenwürfen. Der Einsatz von Schusswaffen wird befohlen, die nicht nur zu Warnschüssen abgefeuert werden. Die Bilanz des Tages sind zwei Schwerverletzte – und der erste Demonstrationstote der noch jungen Bundesrepublik. Es ist der 21-jährige Arbeiter Philipp Müller, der auf dem Weg ins Krankenhaus seiner Schussverletzung erliegt.
Während Müller in der alten Bundesrepublik schnell in Vergessenheit gerät, wird er in der DDR über Jahrzehnte als „sozialistischer Held“ und antifaschistischer Widerstandskämpfer Namensgeber von Straßen, Plätzen, Schulen, Betrieben, Jugendclubs und Medaillen - selbst ein Trawler der DDR Fischereiflotte wurde nach ihm benannt. Wie im Brennglas exemplifizieren sich in der Person Philipp Müllers die Geschichte des Kalten Krieges sowie die im doppelten Wortsinne geteilte Erinnerungskultur des vereinten Deutschlands.
Der Leipziger Historiker und Geschichtsdidaktiker Professor Dr. Alfons Kenkmann stellte am 21. April 2022 die Ergebnisse seiner Forschungen zu Philipp Müller vor.Thu, 21 Apr 2022 - 1h 01min - 1026 - Wir müssen reden! Pandemie und Freiheit
Im Rahmen unserer Diskussionsreihe "Wir müssen reden!" haben wir am 20.04.2022 darüber gesprochen, wie im Laufe der Geschichte der Staat und seine Bürger mit Pandemien umgingen, welche Freiheitsrechte dafür eingeschränkt worden sind und wie die heutige Polarisierung in Impfgegner und Impfbefürworter und die unterschiedlichen Positionen zu den Corona-Maßnahmen einzuschätzen sind. Schlussendlich beschäftigte uns aber auch grundsätzlich die Frage, warum die Stimmung in der deutschen Gesellschaft in dieser Frage so aufgeheizt ist, welche politischen Entscheidungen hierzu beigetragen haben und welche Gefahren für die Demokratie daraus erwachsen können.
Wed, 20 Apr 2022 - 1h 20min - 1025 - Folge 10: Ausreise mit Hindernissen
In der letzten Folge der Podcastreihe "Gegen alle Mauern" geht es um einen der wohl krassesten Brüche im Leben: Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichten von ihrer Ausreise aus der DDR. Einfach war sie in keinem der Fälle, einfach war auch das Ankommen im neuen Leben nicht. Dorothea Fischer, Josephine Keßling, Johanna Kalex, Bernd Stracke, Jürgen Gutjahr erzählen von schweren Entscheidungen und ihren Konsequenzen.
Eine Produktion von Musealis im Auftrag der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland.
Redaktion: Johannes Romeyke
Sprecherin: Johanna Geißler
Moderation: Martin Becker
Technik: Friedhelm Mund
Recherche: Mattis KilianTue, 18 Oct 2022 - 17min - 1024 - Folge 9: Flucht in die Freiheit
In der vorletzten Folge der Podcastreihe "Gegen alle Mauern" geht es um Wege in die Freiheit, um Versuche junger Leute, irgendwie aus der DDR herauszukommen. Zwei abenteuerliche Geschichten von großen Plänen, die jäh im Niemandsland endeten, nachdem sie hoffnungsvoll begonnen hatten: Anne Hahn und Thomas von Grumbkow erzählen von ihren Versuchen, über Aserbaidschan bzw. Bulgarien über die grüne Grenze in den Westen zu fliehen.
Eine Produktion von Musealis im Auftrag der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland.
Redaktion: Johannes Romeyke
Sprecherin: Johanna Geißler
Moderation: Martin Becker
Technik: Friedhelm Mund
Recherche: Mattis KilianTue, 11 Oct 2022 - 21min
Podcasts similar to Geschichte(n) hören
 Mit den Waffeln einer Frau barba radio, Barbara Schöneberger
Mit den Waffeln einer Frau barba radio, Barbara Schöneberger radioWissen Bayerischer Rundfunk
radioWissen Bayerischer Rundfunk Der Tag Deutschlandfunk
Der Tag Deutschlandfunk Die Nachrichten Deutschlandfunk
Die Nachrichten Deutschlandfunk Psychologie to go! Dipl. Psych. Franca Cerutti
Psychologie to go! Dipl. Psych. Franca Cerutti Kriminalhörspiel Hörspiel und Feature
Kriminalhörspiel Hörspiel und Feature Die Ernährungs-Docs - Essen als Medizin NDR
Die Ernährungs-Docs - Essen als Medizin NDR Zwischen Hamburg und Haiti NDR Info
Zwischen Hamburg und Haiti NDR Info Gysi gegen Guttenberg – Der Deutschland Podcast Open Minds Media, Karl-Theodor zu Guttenberg & Gregor Gysi
Gysi gegen Guttenberg – Der Deutschland Podcast Open Minds Media, Karl-Theodor zu Guttenberg & Gregor Gysi "Kein Mucks!" – der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka (Neue Folgen) Radio Bremen
"Kein Mucks!" – der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka (Neue Folgen) Radio Bremen Sinnlos Märchen RADIO PSR
Sinnlos Märchen RADIO PSR Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft RTL+ / Philipp Fleiter
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft RTL+ / Philipp Fleiter Das Wissen | SWR SWR
Das Wissen | SWR SWR SWR1 Leute SWR
SWR1 Leute SWR Kurt Krömer - Feelings Wondery
Kurt Krömer - Feelings Wondery Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen ZDF - Aktenzeichen XY
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen ZDF - Aktenzeichen XY LANZ & PRECHT ZDF, Markus Lanz & Richard David Precht
LANZ & PRECHT ZDF, Markus Lanz & Richard David Precht Verbrechen ZEIT ONLINE
Verbrechen ZEIT ONLINE ZEIT WISSEN. Woher weißt Du das? ZEIT ONLINE
ZEIT WISSEN. Woher weißt Du das? ZEIT ONLINE
Other Education Podcasts
 Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen WELT
Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen WELT Einschlafen mit Wikipedia Wikipedia & Schønlein Media
Einschlafen mit Wikipedia Wikipedia & Schønlein Media Alles Geschichte - History von radioWissen Bayerischer Rundfunk
Alles Geschichte - History von radioWissen Bayerischer Rundfunk Deutsch Podcast - Deutsch lernen Deutsch-Podcast
Deutsch Podcast - Deutsch lernen Deutsch-Podcast Geschichten aus der Geschichte Richard Hemmer und Daniel Meßner
Geschichten aus der Geschichte Richard Hemmer und Daniel Meßner Verbrechen der Vergangenheit RTL+ / GEO EPOCHE / Audio Alliance
Verbrechen der Vergangenheit RTL+ / GEO EPOCHE / Audio Alliance Eine Stunde History - Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk Nova
Eine Stunde History - Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk Nova WDR Zeitzeichen WDR
WDR Zeitzeichen WDR Easy German: Learn German with native speakers | Deutsch lernen mit Muttersprachlern Cari, Manuel und das Team von Easy German
Easy German: Learn German with native speakers | Deutsch lernen mit Muttersprachlern Cari, Manuel und das Team von Easy German 6 Minute English BBC Radio
6 Minute English BBC Radio MORD AUF EX Leonie Bartsch & Linn Schütze
MORD AUF EX Leonie Bartsch & Linn Schütze Englisch lernen mit Jicki Jicki - Sprachduschen
Englisch lernen mit Jicki Jicki - Sprachduschen Deutsch lernen - Deutsch-D1-Audio-Erlebnis Deutsch D1
Deutsch lernen - Deutsch-D1-Audio-Erlebnis Deutsch D1 Deutsch Training Podcast deutschtraining.org
Deutsch Training Podcast deutschtraining.org Deutsch lernen durch Hören www.einfachdeutschlernen.com
Deutsch lernen durch Hören www.einfachdeutschlernen.com GESUNDHEIT KANNST DU LERNEN Dr. med. Cordelia Schott
GESUNDHEIT KANNST DU LERNEN Dr. med. Cordelia Schott Die Märchentante, Meditation und Geschichten zum Einschlafen Alexandra Matthes
Die Märchentante, Meditation und Geschichten zum Einschlafen Alexandra Matthes Was bisher geschah - Geschichtspodcast Wondery
Was bisher geschah - Geschichtspodcast Wondery Podcast Historyczny Rafał Sadowski
Podcast Historyczny Rafał Sadowski Meditation zum Einschlafen Ralf Lederer
Meditation zum Einschlafen Ralf Lederer