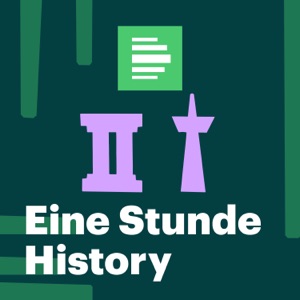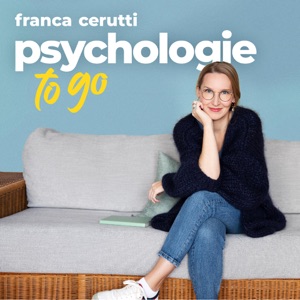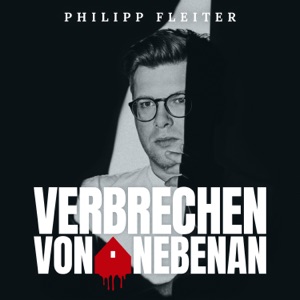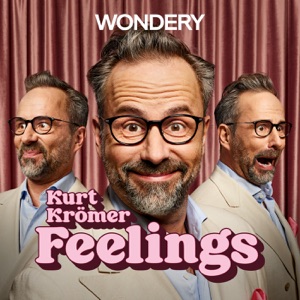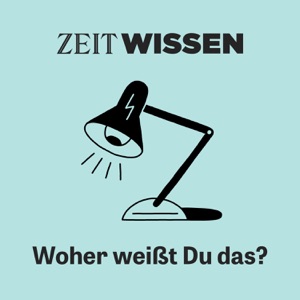Filtrar por gênero
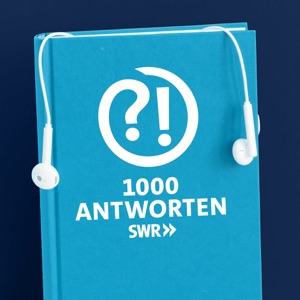
Woher stammt die "Quarantäne"? Wie entsteht ein Schwarzes Loch? Warum fallen Wolken nicht vom Himmel? SWR-Redakteur Gábor Paál und unsere Gäste aus der Wissenschaft erklären Ihnen hier jeden Tag ein kleines Stückchen Welt. | Texte unter http://1000-antworten.de Viele Episoden dieses Podcasts stehen unter einer Creative-Commons-Lizenz. Sie können die Episoden unter Angabe der Quelle und der Lizenz unverändert in Ihrem eigenen Digitalangebot dauerhaft veröffentlichen. Die Episoden dürfen dabei nicht verändert oder kommerziell genutzt werden. Die Lizenz lautet CC BY-NC-ND 4.0.
- 5594 - Warum ist der Himmel blau?
Für dieses Phänomen gibt es eine physikalische Erklärung und eine psychologische.
Lichtstreuung: blaue Lichtanteile werden stark abgelenkt
Die physikalische Erklärung hat mit der Lichtstreuung zu tun: Das Sonnenlicht muss auf seinem Weg zur Erde durch die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist wiederum voll mit allen möglichen Gasmolekülen. Wenn das Sonnenlicht auf diese kleinen Teilchen trifft, wird es gestreut, d.h. umgelenkt. Dabei wird das weiße Licht gleichzeitig in seine Bestandteile zerlegt, wie bei einem Prisma. Es wird also aufgespalten in die Regenbogenfarben: blau, grün, gelb, orange, rot. Die verschiedenen Farben werden unterschiedlich stark gestreut. Die Streuung ist umso stärker, je kleiner die Wellenlänge ist oder anders gesagt, je energiereicher die Strahlen sind. Nun sind blaue Strahlen energiereicher als rote. Die blauen Lichtanteile werden deshalb viel stärker bei der Streuung abgelenkt. Stellen wir uns nun einen wolkenfreien Himmel vor. Irgendwo an diesem Himmel steht die Sonne; die ist weiß bis gelb, auf jeden Fall ziemlich hell. Sie strahlt aber in alle Richtungen, nicht nur in unser Auge, sondern auch in die übrige Atmosphäre. Einige dieser Strahlen werden in der Atmosphäre so stark gestreut, dass sie wieder in unsere Richtung zurückgelenkt werden, also unser Auge treffen. Das sind aber nur die stark gestreuten Lichtstrahlen, sprich die eher blauen Anteile. Die roten Lichtstrahlen dagegen werden nicht so stark abgelenkt, das heißt, die erreichen uns gar nicht mehr. Der Himmel ist also blau, weil nur die blauen Lichtstrahlen so stark gestreut und abgelenkt werden, dass sie auf unser Auge treffen.Sprache prägt Wahrnehmung: Wir kennen ein Wort für die Farbe "Blau"
Der Himmel erscheint uns auch deshalb blau, weil wir ein eigenes Wort für die Farbe Blau haben. Das sagt uns die Sprachwissenschaft: Es gibt Sprachen auf der Welt, die unterscheiden nicht zwischen Grün und Blau, sondern haben dafür nur ein Wort. Man kann davon ausgehen, dass diese Menschen Grün und Blau nicht als zwei verschiedene Farben wahrnehmen, sondern eher als verschiedene Schattierungen eines Farbtons. Es gibt sogar Sprachen, die nur drei Farbwörter haben, nämlich Schwarz, Weiß und Rot – wobei Schwarz und Weiß dann mehr oder weniger gleichbedeutend sind mit dunkel oder hell. Wenn man Menschen in diesem Sprachraum fragt, welche Farbe der Himmel hat, dann ist für sie der Himmel meist dunkel, gelegentlich hell und abends vielleicht auch mal rot. Aber einen „blauen“ Himmel kennen sie nicht, weil sie kein Wort für Blau haben und offenbar Blau auch nicht als eine eigenständige Farbe wahrnehmen. In dem Sinn prägt die Sprache wohl tatsächlich die Wahrnehmung.Sat, 14 Jan 2023 - 03min - 5593 - Hat Ostern germanische Ursprünge?
Die Vermutungen, dass hinter Ostern germanische Ursprünge stecken, sind sehr vage. Wir sind in der heutigen Volkskunde bzw. der Europäischen Ethnologie von diesen sogenannten Kontinuitätsprämissen abgerückt und zweifeln die germanischen Kontinuitäten an. Auch die Namensherleitung von Ostern geht in eine ähnliche Richtung – den Namen in Verbindung zu bringen mit einer angeblichen germanischen Göttin namens Ostara ist äußert schwierig. Denn es spricht vieles dafür, dass es eine solche germanische Göttin nie gegeben hat.
Vermutlich indogermanische Wurzeln
Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass aus dem Indogermanischen ein Wort wie "Eostra" im Hintergrund gestanden haben könnte, das so viel bedeutet wie "Morgenröte". Und das macht ja auch Sinn. Mit Ostern kommt sozusagen neues Licht in die Welt – die "Morgenröte der Erlösung". Das ist sehr viel besser nachvollziehbar.Fri, 29 Mar 2024 - 01min - 5592 - Wie atmen Küken im Ei, bevor sie schlüpfen?
Luftblase im Ei versorgt das Küken mit Sauerstoff
Was machen wir, wenn wir ein Frühstücksei kochen und verhindern wollen, dass es beim Kochen platzt? Wir stechen es an, an der stumpfen Seite. Warum? Weil da eine Luftblase ist. Diese Luftblase kann sich ausdehnen, wenn sie erhitzt wird, und dann droht sie zu platzen. Genau diese Blase dient dem Küken als Luftreservoir. Dort atmet es. Während das Küken im Ei heranwächst, wird die Luftblase immer größer, weil aus dem Ei Flüssigkeit verdunstet. Damit wächst der Luftanteil im Ei, und so hat auch das Küken mit der Zeit ein immer größeres Luftreservoir zur Verfügung.Eierschale hat 10.000 Poren
Trotzdem klingt es vielleicht seltsam: Das bisschen Luft in dieser doch recht kleinen Blase soll reichen, um ein Küken bis es schlüpft – also drei Wochen lang – mit Sauerstoff zu versorgen? Wie soll das gehen? Denn die Eierschale selbst ist luftdurchlässig. In der Eierschale eines normalen Hühnereis befinden sich 10.000 Poren, über die ein ständiger Luftaustausch stattfindet. So kommt Sauerstoff ins Ei und somit auch in diese Luftblase.Wann und wie das Küken schlüpft
Mit der Zeit wird es im Ei natürlich eng. Dann hämmert das Küken das Ei von innen auf und schlüpft. Draußen gibt es dann in jedem Fall genügend Luft.Tue, 26 Mar 2024 - 01min - 5591 - Tipp: "Ah&Oh" von ARD Wissen – neuer Instagram-Kanal
Im neuen Instagram-Kanal "Ah&Oh" von ARD Wissen gibt es viele Aha-Effekte und faszinierende Phänomene. Wenn Ihr Instagram nutzt, guckt doch mal rein: https://1.ard.de/ahundoh
Wed, 13 Mar 2024 - 01min - 5590 - Könnte man etwas unsichtbar machen, wenn man es mit ultravioletter Farbe bestreicht?
Nein, aber die Idee klingt natürlich bestechend. Andererseits: Wenn es möglich wäre, hätte das wohl schon mal jemand gemacht. Wo also ist der Haken? Andersherum gefragt: Wann ist etwas überhaupt sichtbar?
Sichtbar sind entweder Objekte, die selber Licht erzeugen und ausstrahlen – wie die Sonne oder eine Glühlampe – oder Objekte, Oberflächen, die Licht reflektieren. Fast alles, was wir täglich sehen, sind Oberflächen, die Sonnenlicht reflektieren.
Und weiter:Quelle: Hans Kricheldorf, Professor für makromolekulare Chemie
Man muss unterscheiden, dass es zwei Arten von „sehen“ gibt. Nämlich das physikalische Sehen – es kommt Licht und dringt in unser Auge ein. Das ist der physikalische Teil des Sehens. Aber was uns bewusst wird, bedarf einer Verarbeitung durch das Gehirn; das will ich als das „Wahrnehmen“ bezeichnen. Das ist nun wichtig, wenn wir fragen: Was ist unsichtbar und was ist sichtbar?
Entsprechend, erklärt der Materialwissenschaftler, gibt es auch zwei Varianten der Unsichtbarkeit. Variante 1 bedeutet: Unsichtbar im Sinne von durchsichtig, transparent.Quelle: Hans Kricheldorf, Professor für makromolekulare Chemie
Luft zum Beispiel oder eine hochtransparente Glasscheibe können wir physikalisch nicht sehen, weil von dort kein Licht zu uns zurückkommt.
Und gleich die Einschränkung: Luft strahlt durchaus. Sie sendet elektromagnetische Wellen durch den Raum. Doch diese können wir nicht sehen, denn unsere Augen sind nur für einen winzigen Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums überhaupt empfänglich. Wir sehen keine Radiowellen – deren Wellenlänge ist viel zu lang. Wir sehen keine Röntgenstrahlen – die sind viel zu kurz. Unsere Augen sind eigentlich ziemlich beschränkt. Sie sehen nur die Farben des Regenbogens, und der ist ein dünner Strich in der Landschaft der elektromagnetischen Wellen. Würden wir die Wellenlängen der Regenbogenfarben in Schallwellen übersetzen, dann entspräche der Abstand zwischen dem inneren und äußeren Rand des Regenbogens gerade mal einer Oktave. Mehr nicht. Alle Lichtfrequenzen, die größer oder kleiner sind, sehen wir nicht.Quelle: Hans Kricheldorf, Professor für makromolekulare Chemie
Alle diese diversen Strahlenbereiche, da strahlt Luft zum Beispiel im Mikrowellen- oder im Infrarotbereich. Wenn Sie Luft von Raumtemperatur vor eine kalte Wand blasen würden, dann würden Sie im Infrarot sehen, dass die Luft Wärme abstrahlt, Infrarotlicht abstrahlt. Dass wir Luft nicht sehen, ist also nur ein Phänomen des ganz kleinen Ausschnitts an Strahlung, den unser Auge wahrnimmt.
Bleibt die Frage: Warum sind manche Stoffe dann durchsichtig – transparent – während andere das Licht reflektieren? Was ist es, was das Licht gewissermaßen im Stoff zur Umkehr zwingt? Es sind Elektronen, so der Experimentalphysiker Metin Tolan:Quelle: Hans Kricheldorf, Professor für makromolekulare Chemie
Wenn elektromagnetische Wellen – Licht – auf einen bestimmten Stoff treffen, werden sie absorbiert oder nicht absorbiert. Das hängt von den Elektronen im Stoff ab. Wenn die Elektronen richtig mitschwingen können, wenn die richtig angeregt werden, werden die elektromagnetische Wellen absorbiert, die Elektronen verschlucken sie sozusagen. Im Glas können die Elektronen nicht so angeregt werden, deswegen ist das Glas durchsichtig.
Glas oder auch Luft sind also durchsichtig, weil es keine Resonanz gibt – die Elektronen sind so eng an die jeweiligen Atome gebunden, dass sie sich von den Lichtstrahlen nicht stören oder gar zum Mitschwingen verleiten lassen. Deshalb geht das Licht einfach durch, ohne seine Energie abzugeben. Aber diese Stoffe sind bekanntlich eher die Ausnahme.Quelle: Metin Tolan, Experimentalphysiker
Bei Metallen ist es genau nicht so. Da sind die Elektronen nicht so fest gebunden, die sind frei beweglich. Deshalb können Sie mit elektromagnetischen Wellen diese Elektronen natürlich auch ganz leicht anregen – und deshalb sind Metalle nicht durchsichtig. Diese Erklärung ist stark vereinfacht, aber das ist der Effekt.
Zoomen wir uns nun wieder etwas heraus aus der Tiefenstruktur der Moleküle, der Atome und Elektronen. Denn da war ja noch die zweite Art der Unsichtbarkeit, von der Hans Kricheldorf gesprochen hat: In dieser Variante gelangen von einem Objekt zwar Lichtstrahlen in unser Auge – wir können es also physikalisch sehen – aber nicht wahrnehmen, einfach deshalb weil wir zwischen Objekt und Hintergrund keine Grenze erkennen können.Quelle: Metin Tolan, Experimentalphysiker
Stellen Sie sich vor, dass Sie ein weißes Blatt Papier auf einen weißen Hintergrund kleben, der genau das gleiche Licht abstrahlt wie das weiße Papier. Jetzt gehen Sie 10 Schritte zurück, sodass Sie den Rand des Papieres nicht mehr sehen. Dann sehen Sie physikalisch das Papier, es strahlt Ihnen nämlich weißes Licht ins Auge – aber Ihr Gehirn kann es nicht mehr wahrnehmen. Und das ist der Witz von Tarnanstrichen oder Tarnüberzügen. Das machen Lebewesen in der Natur oder die Bundeswehr beim Einsatz.
In der Frage , ob man etwas mit ultravioletter unsichtbar machen kann, werden nun genau diese beiden Varianten von Unsichtbarkeit vermischt.Quelle: Hans Kricheldorf, Professor für makromolekulare Chemie
Beim Tarnen können Sie mit Anstrichen etwas erreichen, aber Sie können nicht durch Anstriche etwas komplett durchsichtig machen, so als ob es Luft wäre. Wenn Sie etwas Sichtbarem das reflektierte Licht wegnehmen wollen, würde die Sichtbarkeit für unser Auge nicht verschwinden. Denn wenn Sie einer Oberfläche, die Sie jetzt sehen, weil sie Licht reflektiert, diese Strahlung wegnehmen, dann ist sie einfach schwarz, aber als schwarzes Objekt natürlich sichtbar.
Die "ultraviolette" Farbe wäre natürlich genauso schwarz.Quelle: Hans Kricheldorf, Professor für makromolekulare Chemie
Tue, 12 Mar 2024 - 05min - 5589 - Wie lange braucht ein Lichtsignal vom Objekt ins Gehirn?
Mit Lichtgeschwindigkeit vom Objekt aufs Auge
Erst mal muss das Licht vom Objekt auf die Netzhaut des Auges gelangen. Diese Zeit hängt von der Entfernung des Objekts ab. Da die Lichtgeschwindigkeit bekannt ist – 300.000 km pro Sekunde – kann man die Geschwindigkeit leicht ausrechnen. Wenn ich ein Buch lese, das 30 cm von meinem Auge weg ist, braucht das Licht den hundert millionsten Bruchteil einer Sekunde. Wenn ich einen Baum in 30 Metern Entfernung sehe, dann braucht es 100-mal länger.Vom Auge ins Gehirn dauert's: Nerven arbeiten nicht in Lichtgeschwindigkeit
Das macht also einen Unterschied – aber dieser Unterschied ist eigentlich belanglos: Von besagtem Baum zu meinem Auge braucht das Licht immer noch nur eine Millionstel Sekunde und diese Zeit kann man vernachlässigen. Denn viel länger ist die Zeit, die das Signal auf dem weiteren Weg von der Netzhaut ins Gehirn braucht. Das sind nämlich 50 bis 80 Millisekunden, also nur noch etwa den zwanzigsten Teil einer Sekunde. Das heißt, die Übertragungsgeschwindigkeit in den Nerven ist viel langsamer als das Licht. Man kann das auch anders anschaulich machen: Die Zeit, die das Signal vom Objekt zum Auge braucht, fällt erst bei astronomischen Größenordnungen ins Gewicht. Ein guter Anhaltspunkt wäre ein Asteroid, der in knapp 30.000 km Entfernung an der Erde vorbei saust; das ist knapp ein Zehntel der Strecke Erde/Mond. Da kann man wirklich sagen: Das Licht braucht vom Asteroiden zum Auge ungefähr so lange wie auf den restlichen Zentimetern vom Auge zur Sehrinde im Gehirn. Wir haben nun zwei Etappen betrachtet:- Etappe: Der Lichtweg vom Objekt zur NetzhautEtappe: Die Nervenübertragung vom Auge ins Gehirn
Gehirn braucht "Rechenzeit", bis ein Bild entsteht
Es fehlt aber noch etwas. Denn was im Gehirn ankommt, sind unzählige elektrochemische Nervensignalen – die muss das Gehirn noch verarbeiten, um aus den vielen Signalen ein Gesamtbild zu konstruieren. Das ist also "Rechenzeit", und die dauert ungefähr nochmal so lange. Bis wir also ein Objekt wirklich erkennen, brauchen wir ungefähr 150 Millisekunden – also etwa eine Siebtel Sekunde. Und die allermeiste Zeit davon verbringt das Signal sozusagen "in unserem Kopf". Der Lichtweg vom Objekt zum Auge spielt erst eine Rolle, wenn wir zum Mond oder zu den Sternen gucken; auf der Erde ist er vernachlässigbar. Insgesamt kann man schon sagen: Unser Erleben, unsere Wahrnehmung hinkt der Wirklichkeit um mehr als eine Zehntelsekunde hinterher.Mon, 11 Mar 2024 - 02min - 5588 - Warum scheinen sich Räder manchmal rückwärts zu drehen?
Wagon Wheel Illusion: Film und Realität unterscheiden
Wissenschaftler sprechen hier von der "Wagon Wheel Illusion", also der Wagenrad-Illusion. Dabei muss man zwei Situationen unterscheiden: Film und Realität. Fangen wir mit dem ersten Fall an, da ist die Erklärung ein bisschen klarer. Im Film sehen wir in Wahrheit keine fließende Bewegung, sondern eine schnelle Abfolge von unbewegten Einzelbildern. Pro Sekunde sind das 25 Bilder, die so schnell hintereinander folgen, dass das Auge die einzelnen Bilder nicht mehr unterscheiden kann und das Gehirn aus den Einzelbildern eine Bewegung konstruiert. Jetzt stellen wir uns eine Szene aus einem klassischen Western vor. Dort tritt diese Wagenrad-Illusion besonders häufig auf. In dem Western wird eine Kutsche mit großen Rädern gezeigt. Wir konzentrieren uns auf ein einzelnes Rad und tun so, als hätte dieses Rad nur eine einzige Speiche. Dieses Rad würde sich im Uhrzeigersinn drehen. Nun sehen wir also 25 Bilder pro Sekunde. Beim ersten Bild steht die Speiche senkrecht nach oben, praktisch auf 12 Uhr. Das zweite Bild zeigt das gleiche Rad 1/25 Sekunde später. Jetzt könnte es passieren, dass das Rad in dieser 1/25 Sekunde genau eine volle Umdrehung vollzogen hat. Die Speiche stünde dann auf dem zweiten Bild wieder auf der 12-Uhr-Position. Beim dritten Bild ebenfalls und so weiter. Für den Zuschauer würde es dann so aussehen, als stünde das Rad still – denn die Speiche bewegt sich scheinbar nicht von der Stelle. Nun stellen wir uns vor, dass das Rad in 1/25 Sekunde keine volle Umdrehung macht, sondern ein bisschen langsamer ist. Die Speiche hat also nach der ersten 1/25 Sekunde noch nicht wieder die 12-Uhr-Position erreicht, sondern hat es nur bis zur 11-Uhr-Position geschafft. Auf dem dritten Bild ist es in der 10 Uhr-Position usw. Wenn wir diese Bildabfolge nun schnell hintereinander sehen, dann dreht sich das Rad scheinbar langsam rückwärts, also linksherum – 12 Uhr, 11 Uhr, 10 Uhr. Warum? Weil das Gehirn darauf programmiert ist, möglichst einfach und in kurzen Wegen zu denken: Wenn wir zwei Bilder sehen und auf dem einen die Speiche in der 12-Uhr-Position steht und auf dem nächsten auf der 11-Uhr-Position, dann konstruiert das Gehirn daraus eine kurze Bewegung linksherum von 12 nach 11. Den langen Weg rechtsherum zieht es gar nicht erst in Betracht. Wenn die Wahrnehmung es zulässt, geht das Gehirn also immer davon aus, dass sich Dinge langsam bewegen. Wagenräder haben bekanntlich mehr als eine Speiche. Das Beispiel sollte nur helfen, sich das Prinzip zu verdeutlichen. Das normale Kutschrad hat meist 12 Speichen. Da funktioniert das genauso. Sogar noch eher, weil für den Zuschauer ja eine Speiche aussieht wie die andere. Das heißt, um diesen langsamen Rückwärtseffekt zu erzeugen, muss gar nicht die einzelne Speiche eine voll bzw. fast volle Umdrehung machen, sondern es genügt, wenn nach 1/25 Sekunde die nachfolgende Speiche eine Position in der Nähe der ersten Position erreicht. Das Auge des Zuschauers unterscheidet die Speichen nicht, sondern glaubt, dass es sich um die gleiche Speiche handelt wie gerade eben, und sie sich nur etwas gegen den Uhrzeigersinn bewegt hat.Gibt es diesen Effekt nur beim Betrachten von Filmen? Oder auch in der Wirklichkeit?
Die Antwort auf diese Frage ist umstritten. Das bestätigt auch Karl Gegenfurtner, Professor für Wahrnehmungspsychologie an der Universität Gießen. Er selbst meint, dass es diese Wagenrad-Illusion nur im Film gibt. Es gibt aber Leute wie den britischen Forscher Dale Purves, der überzeugt ist, dass der Effekt auch in der Realität auftreten kann. Was darauf hindeuten würde, dass unser Auge normalerweise keine kontinuierlichen Bewegungen wahrnimmt, sondern auch hier Bewegung wie eine kurze, schnell hintereinandergeschaltete Sequenz von Einzelbildern verarbeitet. Wie wenn wir einen Film gucken – und eben nicht in einem zeitlich kontinuierlichen Strom. Das ist aber noch nicht einhellig geklärt. Unter Umständen kann der Effekt auch bei elektrischem Licht auftreten. Normale Glühbirnen, die mit Wechselstrom betrieben werden, erzeugen ja in Wahrheit kein Dauerlicht, sondern flackern sehr schnell. Das heißt, die Lichtintensität schwankt 50-mal in der Sekunde. Das Auge nimmt das normalerweise nicht wahr, aber dieses Flackern könnte einen ähnlichen Effekt haben wie die schnelle Bildabfolge beim Film.Mon, 11 Mar 2024 - 04min - 5587 - Schont ein Bio-Shampoo die Umwelt?
Tenside, Duft- und medizinische Wirktstoffe im Shampoo
Shampoos enthalten verschiedene umweltkritische Inhaltsstoffe. Dazu gehören Tenside – also das, was wäscht und schäumt – und Zusatzstoffe wie Duft- oder medizinische Wirkstoffe, etwa gegen Schuppen. Allerdings gibt es nur wenige Untersuchungen darüber, wie diese sich in der Umwelt tatsächlich auswirken. Die Tenside, die heute in konventionellen Shampoos verwendet werden, sind biologisch gut abbaubar. Es gibt aber Hinweise darauf, dass manche Zusatzstoffe hormonelle Wirkungen auf Organismen haben. Die stammen allerdings aus Laboruntersuchungen, bei denen Organismen ganz gezielt hohen Konzentrationen ausgesetzt sind, wie sie in der Natur gar nicht vorkommen. Deshalb folgt daraus noch nicht, dass diese Stoffe in den Mengen, in denen sie sich am Ende im Abwasser finden, wirklich einen nennenswerten Schaden anrichten. Das ist einfach schwer untersuchbar. Aber auch wenn man es nicht weiß, sollte man die Umwelt so wenig wie möglich schädigen und deshalb vorsorglich schadstoffarme Produkte verwenden.Was bedeutet "bio" beim Shampoo?
Nun stellt sich aber die nächste Frage: Was bedeutet "bio" überhaupt bei Kosmetik? Der Begriff ist längst nicht so geregelt wie bei Lebensmitteln, wo mit "bio" eine bestimmte Form der Nahrungsmittelproduktion bezeichnet wird – z.B. kein mineralischer Dünger, keine chemischen Pestizide. Was aber sind Bio-Shampoos? Wir sprechen hier ja über Produkte der sogenannten Naturkosmetik. Da gibt es zwar verschiedene Zertifikate, aber die haben fast alle eins gemeinsam: Umweltaspekte spielen bei ihnen kaum eine Rolle. Die Zertifikate werden vielmehr nach anderen, vor allem mutmaßlich gesundheitlichen Gesichtspunkten vergeben.Verzicht auf Zusatzstoffe in Naturkosmetik
Diese Kosmetika zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass sie auf bestimmte Zusatzstoffe verzichten, die z.B. bei bestimmten Menschen Allergien auslösen können: Konservierungsstoffe, Emulgatoren oder eine synthetische Parfümierung.Konventionell oder natürlich: Zusatzstoff bleibt Zusatzstoff
Vielleicht unterscheidet sich das Bio-Shampoo aber vom konventionellen auch einfach nur dadurch, dass es diese Stoffe ausschließlich aus natürlichen Quellen gewinnt, also etwa aus Pflanzen. Limonenduft kann z.B. natürlich oder synthetisch hergestellt sein. Sofern es aber chemisch gesehen letztlich die gleichen Substanzen sind, macht es für das Abwasser keinen Unterschied. D.h. je nachdem, welche Duftstoffe genau drin sind, sind die synthetischen genauso harmlos oder bedenklich wie die natürlichen. Man muss also genau hingucken, was beim jeweiligen Shampoo mit "bio" gemeint ist, um sagen zu können, ob es für die Umwelt wirklich besser ist.Ökologische Gesamtbilanz betrachten
Außerdem muss man die ökologische Gesamtbilanz betrachten: Es kann sein, dass eine natürliche Zutat, die aus Pflanzen gewonnen wird, in der Herstellung sehr viel mehr Energie verbraucht als der entsprechende synthetisch hergestellte Stoff. Als Verbraucher ist man aber meist überfordert, das für jedes Produkt herauszufinden. Deshalb würde ich persönlich sagen: Es gibt in unserem Alltag so viele Dinge, von denen wir relativ sicher wissen, dass sie ökologisch gut oder eben schlecht sind. Wir wissen, Radfahren ist besser als Autofahren. Wir wissen, es ist für die Umwelt besser, wenn wir Dinge kaufen, die möglichst lange halten – von Klamotten bis zum Handy – und wenn wir uns nicht immer auf das neueste Gerät stürzen, das gerade auf den Markt kommt. Unser ökologischer Fußabdruck hängt im Wesentlichen von den Faktoren Wohnung, Essen, Mobilität, Kleidung, Essen und vielleicht noch Medienkonsum ab. Verglichen mit all dem, was wir hier gut oder schlecht machen können, ist die Frage, ob ich ein Bio-Shampoo oder ein konventionelles benutze, für die Umwelt relativ bedeutungslos – zumal dann, wenn man wissenschaftlich den Unterschied gar nicht so klar festmachen kann.Thu, 8 Feb 2024 - 03min - 5586 - Woran merken Frauen den Beginn der Wechseljahre?
Unregelmäßiger Zyklus, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen
Hitzewallungen bekommen Frauen typischerweise erst, wenn die Eierstockfunktion nicht mehr viel macht. In der Zeit davor haben sie Hitzewallungen vielleicht nur ab und zu, vielleicht zum Zeitpunkt der Regelblutung. Typischerweise werden die Blutung ganz am Anfang ein bisschen unregelmäßiger. Der Zyklus verkürzt sich ein bisschen: Früher waren es 28 Tage, dann sind es plötzlich nur noch 26 und dann werden die Zyklen zunehmend unregelmäßiger. Und dann kommen diese Symptome wie Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen. Das ist der Klassiker, der in dieser ganz frühen Phase der Wechseljahre auftritt.Viele Stressfaktoren in der Lebensmitte: Kinder, Eltern, Job – und Klimakterium
Es kann auch sein, dass die Frauen häufiger Migräne haben. Sie fühlen sich vielleicht nicht wohl, bemerken eine gewisse Ängstlichkeit, die sie vorher gar nicht hatten. Und ab und zu mal eine Hitzewallung. Aber die stehen häufig in dieser frühen Phase gar nicht im Vordergrund. Das Gemeine daran ist, dass das in eine Phase des Lebens fällt, wo so viel passiert. Es geht dann eben nicht nur um eine hormonelle Veränderungen, sondern man hat in der Lebensmitte vielleicht noch kleine Kinder oder die Kinder sind gerade in der Pubertät. Da stellt sich die Frage: Was mache ich dann mit meinem Leben – von Burn-out bis Bore-out gibt es einfach alles. Oder die Beziehung steht plötzlich noch mal zur Diskussion. Dann gibt es die Eltern, die kränker werden, der Job ... All das läuft parallel zu diesen hormonellen Veränderungen. Deshalb ist das manchmal schwer auseinanderzuhalten und Frauen denken oft gar nicht darüber nach, dass ihre Symptome eigentlich was mit dem Klimakterium zu tun haben könnten, sondern sie denken: Mein Gott, das ist der Job, ich kann nicht mehr, es ist alles viel zu viel geworden. – Das mag sein, aber vielleicht spielen die Hormone dann eben auch eine Rolle.Tue, 5 Mar 2024 - 01min - 5585 - Warum besteht das Leben aus Kohlenstoff?
Lebewesen setzen sich aus nur 6 Bausteinen zusammen
Es gibt 118 chemische Elemente im Periodensystem. Von diesen 118 Elementen gehören nur 6 zu den Bausteinen, aus denen sich Lebewesen zusammensetzen: Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel. Kohlenstoff ist mit Abstand der wichtigste dieser Bausteine. Zwar besteht der menschliche Körper zu etwa 60 Prozent aus Wasser, aber beim eigentlichen organischen Material, bei den Zellen, den Proteinen, der DNA spielen Kohlenstoffverbindungen die Hauptrolle. Sie bilden das Gerüst, das alles zusammenhält.Kohlenstoff: wandlungsfähigstes chemisches Element
Kohlenstoff ist von allen chemischen Elementen das wandlungsfähigste. Das macht ein Zahlenvergleich deutlich: Die Chemie kennt etwa 200.000 „anorganische“ Verbindungen, also Verbindungen ohne Kohlenstoff. Das klingt zwar viel, ist aber nichts im Vergleich zu 20 Millionen Verbindungen mit Kohlenstoff. Aus diesem Grund ist die organische Chemie, die sich ausschließlich mit Kohlenstoffverbindungen befasst, ein so riesiges Fachgebiet. Und ständig werden neue solcher Verbindungen synthetisiert.Warum erzeugt Kohlenstoff eine so große Vielfalt an Stoffen?
Der Grund dafür liegt in der Natur des Kohlenstoffatoms. Es ist nämlich in der Lage, vier Bindungen zu anderen Atomen einzugehen. Das kann Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor oder Schwefel sein – es können aber auch andere Kohlenstoffatome sein; für die gilt dann wieder das Gleiche. Es können Einfach- oder Mehrfachbindungen sein. Auf diese Weise können große dreidimensionale Strukturen entstehen – von sehr einfachen kleinen Molekülen bis zu hochkomplexen Makromolekülen. All das brauchen wir zum Leben. Diese Vielfalt an Strukturen ist eine wichtige Voraussetzung. Denn damit Leben stattfindet, müssen viele verschiedene Stoffe viele verschiedene Aufgaben erfüllen. Sie müssen stabil sein, damit uns beispielsweise die Erdatmosphäre nicht zersetzt! Zu stabil dürfen sie aber auch nicht sein, denn Stoffe müssen sich trotzdem noch ineinander umwandeln können, damit z.B. aus Fetten und Proteinen, die wir mit der Nahrung aufnehmen, neue Körperzellen entstehen. Kohlenstoffverbindungen erfüllen all diese Voraussetzungen.Gibt es noch andere Elemente, die diese Bedingungen erfüllen könnten?
Sowohl in der Science-Fiction als auch in der evolutionären Forschung wird oft Silizium genannt. Siliziumund Kohlenstoff sind sich tatsächlich sehr ähnlich. Sie gehören im Periodensystem zur selben Gruppe, beide können vier Bindungen eingehen. Der Unterschied: Silizium ist ca. 3,5-mal so groß wie Kohlenstoff. Und das macht in der Welt der kleinsten Teilchen schon eine Menge aus! Siliziumverbindungen sind sowohl in Wasser als auch an der Luft instabil. Da reagiert Silizium sofort mit dem Sauerstoff des Wassers oder mit dem Luftsauerstoff. Silizium kann auch keine stabilen Mehrfachbindungen ausbilden, was die Vielfalt möglicher Verbindungen einschränkt. Auf der Erde erscheint es deshalb höchst unwahrscheinlich, dass Leben auf Silizium basiert. Trotzdem: Es wird fleißig danach gesucht! Die Forschungsgruppe der Nobelpreisträgerin Frances Arnold am California Institute of Technology hat es geschafft, ein Enzym aus einem Bakterium so zu modifizieren, dass es Stoffe mit Silizium-Kohlenstoffbindungen bildet. Da scheint der Schritt zu einem Bakterium, dass das Silizium in seinen Organismus einbaut, nicht mehr so weit.Sun, 24 Dec 2023 - 03min - 5584 - Ist Kreidestaub gesundheitsschädlich?
Kaum Studien zur Verträglichkeit von Kreidestaub
Diese Frage betrifft wohl viele Millionen Lehrer weltweit. Und die Zahl der potenziell betroffenen Schüler ist noch viel größer – allerdings sind die Lehrer naturgemäß stärker exponiert, weil sie oft einen Großteil der Unterrichtszeit mit Kreide etwas an die Tafel schreiben. Doch obwohl so viele Menschen betroffen sind, gibt es doch vergleichsweise wenig Studien zu genau dieser Frage: Ist das Einatmen von Kreidestaub bedenklich? Ein paar Untersuchungen habe ich immerhin gefunden. Eine stammt aus Indien und hat die simple Frage gestellt: Wie viel Kreide ist normalerweise überhaupt in der Luft? – Die typische Situation ist ja: Man schreibt etwas an die Tafel. Der meiste Teil der Kreide bleibt an der Tafel. Ein Teil wird aber beim Schreiben zerrieben und fällt früher oder später zu Boden. Bevor der Staub zu Boden fällt, schwebt er in der Luft. Die Forscher konnten zeigen, dass der Staub sich immerhin lange genug in der Luft hält, dass die Person, die unmittelbar an der Tafel steht, einiges davon einatmet. Vor allem wenn er oder sie zusätzlich beim Schreiben den Mund offen hat.Schulkreide besteht aus Gips
"Kreide" ist im geologischen Sinn keine Kreide, wie man sie an den Kreidefelsen von Dover oder Rügen findet – die besteht aus Calcit, also feinem Kalkstein. Schulkreide dagegen besteht in erster Linie aus Gips. Gips ist Kalziumsulfat – ein gesundheitlich unbedenkliches Material. Giftig in dem Sinn, dass es Langzeitschäden verursacht, ist es nicht. In der Regel nimmt man auch nicht solche Mengen auf, dass die Lunge damit nicht fertig wird. Es sei denn, sie ist ohnehin schon angeschlagen, zum Beispiel, weil man eine Erkältung hat oder die Bronchien entzündet sind.Staubfreie Produktion mittels Kasein
Um auch das zu vermeiden – und weil der Kreidestaub lästig ist – sind die Kreidehersteller schon vor einiger Zeit dazu übergegangen, Kreide möglichst staubfrei zu produzieren. Um das zu erreichen, wird der Kreide oft ein anderer Stoff beigemischt, nämlich Kasein. Kasein ist ein Milcheiweiß. Eine Studie hat gezeigt, dass dieses Kasein wiederum ein Problem für Allergiker darstellen könnte. Eine Studie mit Schülern unterschiedlichen Alters kam zu dem Ergebnis: Bei Kindern, die eine Milchallergie haben, könnte das Einatmen von Kreidestaub allergische Reaktionen hervorrufen, unter Umständen sogar Asthma begünstigen. Zumindest sind einzelne Fälle belegt. Die Zahl der untersuchten Kinder ist allerdings noch zu gering, um sagen zu können, welche Rolle die Kreide dabei wirklich gespielt hat.Vorsicht bei Milchallergie
Trotzdem könnte man daraus den Ratschlag ableiten: Wer eine Milchallergie hat, sollte vielleicht dem Staub möglichst aus dem Weg und beim Schreiben nicht extra nah an die Tafel gehen. Inzwischen gehen ja auch immer mehr Schulen von den klassischen Tafeln zum Whiteboard über – wo sich das Problem nicht mehr stellt.Sat, 17 Jun 2023 - 03min - 5583 - Spinne am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen – woher kommt das?
Spinnen war für die meisten Frauen eine Feierabendtätigkeit. Da war es dann auch "erquickend und labend", denn so heißt es weiter: "Spinne am Abend – erquickend und labend." Wer allerdings am Morgen schon spinnen musste, so die Forschungsmeinung bis vor einigen Jahren, der hatte offenbar keine andere Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Damit konnte man also nur wenig Geld verdienen, insofern bedeutete das "Kummer und Sorgen". Das ist aber nur eine sekundäre Erklärung, die man sich so zurechtgelegt hat.
Aberglaube: Spinne als böses Omen
Ursprünglich geht es um Aberglauben. Die Spinne wird als eine Art Omen, als schlechtes Vorzeichen bewertet. Das findet man ähnlich auch in anderen europäischen Sprachen, beispielsweise im Französischen oder auch im Englischen, wo es heißt: A spider in the morning is a sign of sorrow. – Also: Eine Spinne am Morgen ist ein Vorzeichen von Sorgen, von Nöten. Das ist also die eigentliche Erklärung: Der Volksaberglaube, dass eine Spinne ein böses Vorzeichen wäre.Wed, 13 Sep 2023 - 01min - 5582 - Sind Pilze Pflanzen?
Eigentlich sagen Biologen sogar, Pilze sind den Tieren ähnlicher als den Pflanzen. Wenn man im Wald unterwegs ist, sieht man Bäume, Sträucher, Gräser und dazwischen auch Pilze. Die wachsen so schön nach oben wie ein Baum. Daher könnte man denken, dass die Pilze zu den Pflanzen gehören. Allerdings fallen doch ein paar Unterschiede auf.
Keine Blätter, keine Nadeln – Pilze machen keine Photosynthese
Pilze haben nichts Grünes. Keine Blätter, keine Nadeln. Das ist keine belanglose Äußerlichkeit, sondern das liegt daran, dass Pilze einen völlig anderen Stoffwechsel haben und auch ihre Energie ganz anders gewinnen. Pflanzen haben grüne Blätter, weil sie mit dem Chlorophyll in den Blättern Sonnenlicht in Energie umwandeln. Und sie bauen aus dem Kohlendioxid in der Luft ihre Biomasse auf. Sie wachsen sozusagen mit Sonnenlicht und Luft.Pilze sind Schmarotzer – sie bauen fremde Biomasse ab
Pilze können das nicht. Sie sind, wenn man es negativ sagen will, Schmarotzer – genau wie Tiere und Menschen auch. Wir beziehen unsere Energie eben nicht aus Sonnenlicht, sondern wir müssen essen. Wir gewinnen Energie, indem wir bereits vorhandene Biomasse chemisch abbauen. Und so geht auch der Pilz vor: Auch er ernährt sich, indem er fremde Biomasse abbaut und verstoffwechselt. Das sind entweder abgestorbene Pflanzenreste, die er sich aus dem Boden holt. Oder er hängt sich an eine lebende Pflanze und geht mit ihr eine Art Partnerschaft ein, eine Symbiose. Aber entscheidend ist, er baut fremde Biomasse ab, genau wie Tiere.Zellaufbau unterscheidet Pilz vom Tier
Ein Tier ist der Pilz aber auch nicht. Denn er bewegt sich nicht von der Stelle. Aber das ist nicht das ausschlaggebende Kriterium – Korallen zählt man auch zu den Tieren, obwohl sie sich nicht fortbewegen. Der entscheidende Unterschied zu den Tieren ist der Zellaufbau. Hier wiederum sind die Pilze den Pflanzen ähnlicher, denn sie haben zusätzlich zur Zellmembran noch eine feste Zellwand. Das haben tierische Zellen nicht.Pilze bilden ein eigenes Reich
Außerdem vermehren sich Pilze auch ganz anders als Tiere. Deshalb bilden sie eine Gruppe für sich; ein, wie Biologen sagen, eigenständiges Reich – parallel zum Reich der Tiere und dem Reich der Pflanzen.Fri, 1 Sep 2023 - 02min - 5581 - Woher kommen die Wörter "Katastrophe" und "Desaster"?
Katastrophe: verhängnisvolle Sternenkonstellation
In beiden Wörtern stecken die Sterne drin, lateinisch Astra. Eine Katastrophe ist ein folgenschweres Unglück, etwas, was nach landläufiger Vorstellung über uns hereinbricht ober aber durch menschliches Versagen ausgelöst wird. Früher wurde die Verantwortung dafür den Sternen zugeschrieben, genauer: den Planeten. Man glaubte, dass sie die Erde umkreisen und dabei manchmal eine verhängnisvolle Konstellation einnehmen, bei der eine bestimmte Umdrehung (griechisch καταστροφή) auf die irdischen Verhältnisse so einwirkt, dass sie sich im Positiven oder Negativen verändern. Schon in der Antike waren die Menschen überzeugt, so wie der Mond Ebbe und Flut auslöst, so würden auch die Planeten den Lauf der Ereignisse bestimmen. Diese Vorstellungen herrschten schon in Mesopotamien und hielten sich bis in die Neuzeit. 1932 gab es ein schweres Erdbeben in Indien. Damals wurde unter Wissenschaftlern noch diskutiert, ob das durch eine bestimmte Sternenkonstellation ausgelöst wurde.Desaster: ein "Unstern"
Beim Wort Desaster ist es ganz ähnlich. Auch das hat seinen Ursprung in der frühen Astrologie. Das Wort "disastro" geht auf die Vorstellung zurück, dass eine ungünstige Sternenkonstellation – in der Übersetzung also ein "Unstern", ein "Desaster" – einen negativen Einfluss auf irdische Verhältnisse ausübt.Tue, 27 Feb 2024 - 01min - 5580 - Warum zieht es "wie Hechtsuppe"?
Man liest oft, "es zieht wie Hechtsuppe" komme von "hech sup(p)ha", ein angeblich jiddisch-hebräischer Ausdruck für "Windsbraut, starker Sturm". Allerdings finden sich die Worte so nirgendwo, wie der Jiddist Simon Neuberg bestätigt, schon gar nicht als Bezeichnung für schlecht schließende Fenster.
Würzige Fischsuppe muss kräftig ziehen
In Wirklichkeit bezog man sich im Deutschen auf die Ähnlichkeit von einer traditionell scharf gesalzenen und gepfefferten Fischsuppe mit einem scharfen Luftzug. Das hat damit zu tun, dass Fischsuppe ziehen muss, damit sich der Geschmack der Fische der Brühe mitteilt. Deswegen sagte man auch, wenn es durch Fensterritzen zog: "Das zieht wie eine Fischsuppe." Das hat sich dann um 1800 weiterentwickelt. Da war der Hecht ein besonders toller Fisch. Und so war "es zieht wie Hechtsuppe" statt "es zieht wie Fischsuppe" einfach eine verstärkende Variante.Mon, 26 Feb 2024 - 01min - 5579 - Wie entstand die Kunst?
Evolutionär betrachtet, ist die Frage knifflig. Die Evolutionsforschung fragt ja meist nach dem Warum: Wozu ist Kunst gut? Theoretisch ist ja eine Welt denkbar, in der menschliche Wesen ihr Überleben genauso sichern wie wir – sie arbeiten, essen, pflanzen sich fort – produzieren aber keine Kunst, haben nicht einmal die Spur einer ästhetischen Erfahrung, malen keine Bilder und genießen auch nicht die Bilder von anderen. Die meisten Tiere brauchen das ja auch nicht. Zwar gibt es auch im Tierreich so etwas wie Attraktivität, sie spielt auch bei der Partnerwahl eine wichtige Rolle. Aber Attraktivität ist nicht das gleiche wie die Schönheit., die wir bei Kunstwerken erleben.
1. Dekoration: Gegenstände verzieren und ästhetisch anordnen
Wie hat sich nun also Kunst in der Evolution entwickelt? In den archäologischen Spuren lassen sich drei Phasen erkennen. In der ersten Phase begannen unsere Vorfahren damit, Dinge einfach zu verzieren, also in irgendeiner Form ästhetisch zu bearbeiten. Das können ockerfarbene Linien oder geritzte Kerben sein, mit denen Menschen vor mehr als 70.000 Jahren in Südafrika Steine dekorierten. Doch die Entwicklung begann schon mit den frühen Werkzeugen. Vor zweieinhalb Millionen Jahren haben die frühen Vertreter der Gattung Homo begonnen, scharfkantige Steinwerkzeuge herzustellen. Diese Geröllsteine waren noch unförmig und offenbar reine Zweckgegenstände zum Bearbeiten von Stöcken und Fellen oder zum Graben. Doch rund 800.000 Jahre später tauchte dann eine neue Art von Werkzeugen auf: Faustkeile. Bei diesen alten Faustkeilen fällt etwas auf: Die Menschen, die sie herstellten, müssen schon einen Sinn fürs Ästhetische gehabt haben. Viele sind erstaunlich symmetrisch – symmetrischer, als es rein vom Zweck her erforderlich gewesen wäre. Manche sind sogar unhandlich groß, so als ginge es eher darum, damit zu imponieren. Vor knapp zwei Millionen Jahren scheinen also die frühen Menschen mit irgendeinem ästhetischen Sinn – zumindest für Symmetrie – ausgestattet zu sein. Anderes Beispiel: Neandertaler haben in der Bruniquel-Höhle in Frankreich vor 170.000 Jahren Tropfsteine abgebrochen und kreisförmig auf den Boden gestellt. Niemand weiß genau, warum, aber die fast perfekte Kreisform deutet darauf hin, dass auch hier ein gewisser ästhetischer Sinn eine Rolle spielte. Das ist also die erste Stufe – Dekoration: Unsere Vorfahren haben angefangen, Dinge zu verzieren oder irgendwie ästhetisch anzuordnen.2. Schmuck: Dinge zu dekorativen Zwecken herstellen
Die zweite Stufe ist Schmuck. Hier werden Gegenstände nicht nur verziert, sondern eigens zu dekorativen Zwecken hergestellt. Dazu gehören die durchlöcherten und mit Ocker eingefärbte Muschelschalen aus der südafrikanischen Blombos-Höhle und Marokko, beide um die 80.000 Jahre alt. Ähnlich alte Funde – wenn auch nicht so sicher datiert – stammen aus Israel und Algerien. Auch hier wurden die Gehäuse von Meeresschnecken offenbar zu Ketten aufgefädelt. Ein wichtiges Merkmal von Schmuck ist, dass er auch schon eine symbolische Bedeutung hat, dass etwas zum Ausdruck gebracht werden soll. Schmuck hat häufig die Funktion, den Status und das Prestige seines Besitzers aufzuwerten. In Algerien wurden die Schmuckstücke aus Muschelschalen 200 Kilometer von der Küste entfernt gefunden, was als Beleg gewertet werden kann, dass für sie ein gewisser Aufwand betrieben wurde. Sie waren etwas wert. Wer den Schmuck trug, fiel auf.3. Kunst: schöpferisches Gestalten
Die dritte Stufe schließlich ist die Kunst im eigentlichen Sinn. Dazu gehören die berühmten eiszeitlichen Skulpturen aus den Höhlen der Schwäbischen Alb, die Höhlen- und Felsmalereien in Frankreich, Spanien, aber auch am anderen Ende der Welt, in Australien. Kunstwerke haben wie Schmuck einen symbolischen Gehalt, aber nochmal auf einer anderen Ebene. Sie stellen etwas dar, sie bilden etwas ab, verweisen auf etwas Äußeres. Kunstwerke verlangen somit nochmal andere kognitive Leistungen als Schmuck. Die ältesten Kunstwerke aus der Schwäbischen Alb oder Australien sind etwa 40.000 Jahre alt und somit deutlich jünger als der älteste Schmuck.Deko – Schmuck – Kunst: 3 Stufen spiegeln kognitive Entwicklung
Dekoration – Schmuck – und schließlich Kunst, das war also die Abfolge. Wie es genau zu dieser Entwicklung kam, darüber gibt es viele Theorien, aber ihr gemeinsamer Nenner ist, dass diese Abfolge eine gewisse kognitive Entwicklung widerspiegelt, insbesondere was die Fähigkeit zum symbolischen Denken betrifft. Dabei könnte auch die Entstehung der Sprache eine wichtige Rolle gespielt haben. Frühe Formen von Sprache entwickelten sich mutmaßlich vor rund 250.000 Jahren, möglicherweise aber auch schon deutlich früher. Zur Sprache gehört, dass es Wörter oder Laute gibt, denen eine Bedeutung zugeschrieben wird. Ein Wort bezeichnet etwas. So wie Schmuck oder Kunstwerke Zeichen für etwas sind. Das symbolische Denken war somit eine Voraussetzung sowohl für Sprache als auch für Kunst – und möglicherweise haben sich beide Fähigkeiten gegenseitig befruchtet.Fri, 23 Feb 2024 - 05min - 5578 - Tee und Kaffee sorgen für Harndrang und kalte Füße – warum?
Beide Effekte hängen miteinander zusammen. Viele Leute bekommen kalte Füße, wenn sie einige Tassen Kaffee bzw. schwarzen oder grünen Tee getrunken haben. Das ist gerade im Winter etwas schade, wenn man den Tee zum Aufwärmen trinkt. Das funktioniert zwar erstmal, der Tee wärmt von innen, aber wenn Hände und Füße nach einer Weile kalt werden, ist der schöne Effekt dahin. Und dann muss man meist auch bald schon aufs Klo.
Koffein sorgt für Verengung der Blutgefäße
Tatsächlich bedingt das eine auch das andere – und das liegt am Koffein. Koffein ist sowohl im Kaffee als auch im schwarzen und grünen Tee enthalten. Und Koffein hat viele Wirkungen. Eine ist, dass sich die Muskelfasern rund um die Blutgefäße zusammenziehen und sich die Blutgefäße dadurch verengen. Damit haben wir schon die Erklärung für die kalten Hände und Füße, denn dort, in den Extremitäten, spüren wir diese Kontraktion der Blutgefäße am schnellsten.Blutdruck steigt und die Nieren werden aktiver
Wenn sich aber nun die Blutgefäße zusammenziehen, steigt außerdem der Blutdruck – denn das Blut in den Adern hat dann weniger Platz und steht somit buchstäblich stärker unter Druck. Diese Wirkung ist nur kurzfristig und klingt nach einer halben Stunde wieder ab. Doch der Körper versucht, diesen erhöhten Blutdruck abzubauen. Das geschieht, indem die Nieren aktiver werden. Die Nieren haben die Aufgabe, das Blut zu filtern, holen die Stoffe heraus, die ausgeschieden werden sollen, und mit ihnen Flüssigkeit. Wenn nun die Nieren aktiver werden, produzieren sie mehr Urin – und das sorgt für den verstärkten Harndrang. So hängt alles – die kalten Füße, der erhöhte Blutdruck und die harntreibende Wirkung – miteinander zusammen. Und Auslöser ist das Koffein im Kaffee oder Tee.Fri, 23 Feb 2024 - 01min - 5577 - Wie funktioniert der Nahrungs-Replikator bei "Raumschiff Enterprise"?
Replikatoren bauen aus Elementarteilchen neue Materie
Die Nahrungs-Replikatoren sind Maschinen auf dem Raumschiff Enterprise, die die Nahrung generieren. Grob beschrieben: Wir haben irgendwo ein Lager an Material. Ähnlich wie beim Beamen nimmt man dieses Material, formt es um in seine Elementarteilchen und baut daraus eine andere Materie. Beim Beamen will man die Person genauso wieder haben. Beim Nahrungs-Replikator nimmt man irgendetwas, im einfachsten Fall Wasser, und macht daraus Wiener Schnitzel mit Pommes.Replikation von Nahrung auf diese Weise real nicht möglich
Wenn wir das Beamen beherrschen würden, könnten wir natürlich auch das hier beherrschen. Wir bräuchten ja nur das "Rezept" einzugeben. Aber da sehe ich in nächster Zeit, zumindest für diese Art der Technologie, keine Chance, dass wir das erleben werden. Aber wir sind bei der Herstellung von Nahrung mit 3-D-Druckern auf einem Weg. Nun will ich das nicht direkt miteinander vergleichen. Aber ich glaube schon, dass es in Zukunft immer mehr kommen wird, dass wir Nahrung auf dieser Art herstellen werden. Wobei ich mir das ehrlich gesagt selbst nicht wünsche. Denn ich liebe ein gutes, saftiges Steak, wenn man das heute noch sagen darf, und möchte mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass wir Nahrung künstlich bei irgendwelchen Chemiefirmen herstellen.Mon, 19 Feb 2024 - 01min - 5576 - Warum haben manche Menschen ein absolutes Gehör?
Was ist der Unterschied zwischen einem absoluten und einem relativen Gehör?
Absolutes Gehör bedeutet, dass ich zu jemandem sagen kann "Sing mal ein G!" – und die Person trifft dann genau den richtigen Ton. Das ist eine besondere musikalische Gabe. Selbst die meisten Musikprofis verfügen nur über ein relatives Gehör. Das heißt: Wenn man ihnen die Note C vorspielt, können sie daraus andere Töne ableiten. Sie können dann zum Beispiel problemlos ein E singen, denn sie wissen, dass zwischen einem C und einem E eine Terz liegt. Menschen mit einem absoluten Gehör brauchen diesen Bezugston nicht; sie können auf Anhieb ein A oder ein C anstimmen.Was ist bei Menschen mit einem absoluten Gehör anders?
Es ist noch nicht hinreichend geklärt, was im Gehör und im Gehirn von Absoluthörern anders abläuft. Aber es ist belegt, dass es Unterschiede gibt. Eine Studie der York University in Toronto von 2019 weist darauf hin, dass bei Absoluthörern Teile des Hörzentrums im Gehirn um die Hälfte größer sind als bei Personen ohne absolutes Gehör. Das Hörzentrum ist für die Verarbeitung von Tonhöhen und Lautstärken zuständig. In der Studie hat bei Menschen mit absolutem Gehör ein deutlich größerer Hirnbereich auf die Tonfolgen reagiert. Außerdem schalten sich bei ihnen auch Hirnzellen benachbarter Hirnareale ein, wenn sie einen Ton hören. Diesen Vorteil scheinen Absoluthörern zu nutzen, um gehörte Töne sehr schnell und präzise bestimmen zu können.Ist ein absolutes Gehör angeboren oder ist es auch erlernbar?
Die meisten Forscher und Forscherinnen gehen davon aus, dass ein absolutes Gehör durch eine Kombination von Veranlagung und Training zustande kommt. Es gibt eine Langzeitstudie mit Kindern ab 6 Jahren. Über Jahre hinweg hat man immer wieder Hirnscans der Kinder gemacht. Dabei stellte sich heraus: Es gibt im Gehirn tatsächlich anatomische Marker für das absolute Gehör, und diese Marker sind genetisch veranlagt. Eine andere, kalifornische Studie von 2006 kam zu dem Ergebnis, dass diejenigen Studienteilnehmenden, die schon mit vier bis fünf Jahren ihren ersten musikalischen Unterricht hatten, wenn sie älter sind auch zu denen gehören, die beim Absoluthören die Bestwerte erreichen. Mit dem absoluten Gehör ist es also ein bisschen wie mit der Fähigkeit, eine neue Sprache ohne Akzent zu sprechen. Erwachsenen gelingt das meist nicht mehr. Und die meisten Forscher gehen davon aus, dass Erwachsene auch kein absolutes Gehör erlernen können. Die andere Frage ist: Kann jedes Kind mit dem richtigen Training ein absolutes Gehör bekommen? Hier gehen die Meinungen auseinander. Die einen glauben, das geht. Andere vermuten, dass das nur Menschen mit einer bestimmten genetischen Veranlagung können. Und manche Forscher gehen noch weiter, sie sagen: Nur spezifisch veranlagte Menschen sind in einer begrenzten frühkindlichen Phase in der Lage, ein absolutes Gehör zu entwickeln.Wie viele Menschen besitzen ein absolutes Gehör?
Experten schätzen die Zahl der Absoluthörer in Europa und Nordamerika auf 1 von 10.000 Menschen. In Asien dagegen gibt es Regionen, in denen fast jeder Zweite ein absolutes Gehör hat. Und da sieht man wieder den Einfluss der Kindheit, denn das wird auf die jeweilige Muttersprache zurückgeführt. Mandarin ist eine sogenannte Tonsprache. Bei ihr hängt die Bedeutung der Wörter von der Tonhöhe ab. Wer also mit dieser Sprache aufwächst, schult sein Ohr darin, Klänge genau zu unterscheiden. So kann das Wort "ma", je nach Tonverlauf, "Mutter", "Hanf", "schimpfen" oder "Pferd" heißen. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass wir ein absolutes Gehör nicht ohne Hörtraining entwickeln können.Tue, 6 Feb 2024 - 03min - 5575 - "Bis in die Puppen wach bleiben" – Woher kommt der Ausdruck?
Friedrich II. und seine Götterstatuen im Berliner Tiergarten
"Bis in die Puppen" ist eine ganz lustige Berliner Redensart. König Friedrich II. hat, als er inthronisiert wurde, am Großen Stern im Tiergarten Götterstatuen aufstellen lassen. Die Berliner waren ein bisschen respektlos und sagten, dass seien die Puppen des Königs. Der spielt sozusagen mit diesen Puppen und lässt sie dort aufstellen. Die Berliner unternahmen gerne von der Stadtmitte aus einen Spaziergang "bis in die Puppen". Das waren so zwei, drei Kilometer, also schon eine ganz schöne Strecke. Deshalb hat sich das zunächst als Redensart herausgebildet für eine lange Strecke, eine große Entfernung.Aus "lange Strecke" wird "langer Zeitraum"
Nun gibt es recht häufig die Entwicklung, dass ein langer Zeitraum auf eine lange Wegstrecke oder umgekehrt eine lange Wegstrecke auf einen langen Zeitraum übertragen wird – und das war hier eben auch so. So sagte man in Berlin irgendwann "bis in die Puppen" wenn man meinte "etwas sehr lange tun".Thu, 2 Nov 2023 - 01min - 5574 - Stirbt man beim Beamen?
Beamen tötet – da lässt sich die Natur kaum überlisten
Das geht ins Philosophische. Ich glaube, selbst wenn wir technisch in der Lage wären, so wie das in Star Trek gezeigt wird, einen Menschen auseinanderzunehmen – die Elementarteilchen, aus denen der Mensch besteht, und das Muster wie der Mensch zusammengebaut ist – und irgendwo anders hin zu transportieren – oder vielleicht auch nur das Muster und dort den Menschen wieder zusammenzusetzen – habe ich mich selbst schon gefragt, ob die Natur so etwas überhaupt zulassen würde. Wir würden den Menschen ja beim Beamen töten; er wäre als Lebensform in dem Moment nicht mehr existent. Könnten wir die die Natur so überlisten, dass wir einen Menschen zerlegen und irgendwo wieder neu erschaffen? Auf diese Frage gibt es keine Antwort, denn so etwas hat bisher noch niemand gemacht.Physik-Nobelpreisträger "beamt" Elementarteilchen
Technisch gesehen sind wir aber zumindest auf einem Weg dahin, weil wir Elementarteilchen ja schon beamen können. Anton Zeilinger hat 2022 den Nobelpreis dafür bekommen, dass er Elementarteilchen von einem Ort zum anderen "gebeamt" hat. Aber ob das mit Lebensformen tatsächlich so möglich wäre, wie es in Star Trek gezeigt wird, das kann keiner wirklich beantworten.Mon, 29 Jan 2024 - 01min - 5573 - Woher kommt der Ausdruck "Hals- und Beinbruch"?
Keine Herleitung aus dem Jiddischen
Ich war lange der Annahme, dass diese Redewendung auf eine aus dem Jiddisch-Hebräisch kommende Formel zurückzuführen sei – "hazlóche un bróche" heißt so viel wie Glück, Erfolg und Segen. Das war der Stand der Forschung vor einigen Jahren. Inzwischen habe ich mit einem Jiddisten, also einem Spezialisten für das Jiddische, gesprochen. Der sagt, dass das ganz undenkbar sei; er sieht da überhaupt keinen Zusammenhang.Viel Glück: Brüche wünschen auch Engländer und Segler
In der Tat sagen wir ja schon lange "das ist kein Beinbruch" um auszudrücken: Das ist nicht schlimm. – Und das Brechen des Halses ist als Drohung oder als Problem sprichwörtlich geworden. Insofern brauchen wir den Übergang oder den Umweg über das Jiddisch-Hebräische gar nicht. Im Englischen kennt man "break a leg", wörtlich "Brich dir ein Bein" – ein Ausdruck, mit dem man Glück wünscht und der mit dem Jiddischen gar nichts zu tun hat. Auch beim Segler-Ausdruck "Mast- und Schotbruch" gibt es keine Verbindung zum Jiddischen. Der Ausdruck "Hals- und Beinbruch" kommt also ganz direkt aus deutscher Tradition.Wed, 13 Sep 2023 - 01min - 5572 - Woher kommt "den inneren Schweinehund überwinden"?
Schweinehund: Sauhund für die Jagd und Schimpfwort für gemeine Menschen
Was ist ein "Schweinehund"? Es geht nicht, wie man denken könnte, um ein Mischwesen aus Hund und Schwein, sondern "Schweinehund" leitet sich ab von den Sauhunden – also Hunden, die früher bei der Wildschweinjagd eingesetzt wurden. Es waren, wie man sich vorstellen kann, aggressive Hunde. Daher kam zunächst das Schimpfwort Schweinehund für eine gemeinen, aggressiven Menschen. "Schweinehund" gehört bekanntlich zu den Wörtern, die in alten ausländischen Filmen gerne mal den Deutschen in den Mund gelegt werden – Schnitzel, Sauerkraut, Schweinehund und "Jawohl!" – daran erkennt man in alten englischen Filmen die unsympathischen Deutschen. Das war also die erste Etappe der Redensart: Der Schweinehund wird zum Schimpfwort für einen fiesen Zeitgenossen.Der "innere Schweinehund" als Bild für niedere Instinkte
In der zweiten Phase wird daraus der innere Schweinehund. Das Bild suggeriert, dass wir alle in uns fiese niedere Instinkte haben. Einer der frühesten Belege für diesen Ausdruck ist eine Rede des SPD-Abgeordneten Kurt Schumacher, nachzuhören im Archivradio des SWR. Am 23. Februar 1932, ein Jahr vor Hitlers Machtergreifung, attackiert Schumacher die Nationalsozialisten. Er wirft ihnen vor, mit ihrer aggressiven Propaganda die niederen Instinkte der Menschen zu bedienen, oder wie er es ausdrückt:Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen."
Für diesen Satz wird Schumacher von Reichstagspräsident Paul Löbe prompt zur Ordnung gerufen. Im Juni desselben Jahres hört man den Ausdruck in einer Rundfunkansprache von Reichswehrminister Kurt von Schleicher. Schleicher war parteilos, sympathisierte aber mit der SA und war hinsichtlich seiner Vorstellung von der Wehrmacht und ihren Soldaten auf einer Linie mit Hitler. In dieser Ansprache sagt er unter anderem:Quelle: Kurt Schumacher (SPD), 23.2.1932
Mir wird so oft gesagt, dass diese Passion, sich drillen zu lassen […] meiner unwürdig wäre. Darauf kann ich nur antworten, dass Menschen, die dafür kein Verständnis haben, nicht das Hochgefühl von jungen Burschen kennen, die ihrem Körper etwas Außerordentliches abgewonnen und das erste Mal in ihrem Leben ihren inneren Schweinehund ganz besiegt haben.
Quelle: Reichswehrminister Kurt von Schleicher, Juni 1932
Der innere Schweinehund muss "besiegt" werden
Damit sind wir bei Etappe 3: der Idee, dass der innere Schweinehund in uns "besiegt" oder "überwunden" werden muss. Das Bild passt insofern auch in diese Zeit, als damals die Theorien eines gewissen Sigmund Freud kursierten, wonach wir innere Triebe haben, die im Konflikt stehen können mit unseren höheren Zielen und Werten. Der "innere Schweinehund" nimmt diese Vorstellungen auf, karikiert sie aber auch ein bisschen. So wie eine andere Redensart, die in den 1930er-Jahren auftaucht: Der "innere Reichsparteitag" als Ausdruck dafür, wenn man innerlich über etwas jubelt oder sich diebisch freut. Zur Entstehung des "inneren Reichsparteitags" haben wir hier im Podcast eine eigene Folge. Bleiben wir beim inneren Schweinehund. Den zu besiegen galt zunächst als eine soldatische Tugend. Nach dem Krieg hat sich der Ausdruck "den inneren Schweinehund überwinden" gehalten und aus dem militärischen Kontext gelöst. Der innere Schweinehund ist in unserer heutigen Sprache auch längst nicht mehr fies und aggressiv, sondern liegt eher faul und bequem auf dem Sofa und knabbert ungesundes Zeug.Mon, 8 Jan 2024 - 03min - 5571 - Kann ein Wetterumschwung Kopfschmerzen auslösen?
US-Studie bestätigt Einfluss von Wetterumschwung auf Kopfschmerz
Offenbar ja. Amerikanische Forscher*innen haben das vor einiger Zeit systematisch untersucht. Sie haben über 7 Jahre lang Daten von über 7.000 Patienten gesammelt. Dabei haben sie die Leute nicht einfach befragt, sondern sich besonders schwerwiegende Fälle herausgesucht – nämlich diejenigen Patienten, die sich in die Klinik begeben haben und bei denen die Diagnose Migräne bzw. "unspezifische Kopfschmerzen" gestellt wurde. Dann haben sich die Forscher die Daten der Wetterämter angeschaut: Wie war am Tag der Aufnahme in die Klinik das Wetter? Und in den drei Tagen vorher? Wie waren die Temperaturen?Wie war der Luftdruck?Wie sah es mit Schadstoffen in der Luft aus?Temperaturanstieg kann Kopfschmerz auslösen
Diese Daten wurden wiederum mit der Wettersituation an anderen Tagen im gleichen Monat verglichen. Das Ergebnis war: Ein Wetterumschwung spielt eine Rolle – vor allem, wenn die Temperaturen steigen: Ein Anstieg von 5°C innerhalb eines Tages erhöht das Kopfschmerzrisiko um etwa 8 Prozent. Wenn es noch wärmer wird, erhöht sich auch das Risiko entsprechend.Sinkender Luftdruck wirkt ebenfalls als Auslöser
Ein Temperatursturz dagegen macht sich nicht bemerkbar, es sei denn, er geht mit fallendem Luftdruck einher. Wenn also der Luftdruck sinkt, begünstigt dies ebenfalls Kopfschmerzen. Keinen Zusammenhang konnten die Wissenschaftler beim Faktor Luftverschmutzung feststellen. Schadstoffe in der Luft sind zwar generell eine Belastung für den Körper, erhöhen aber offenbar nicht das Kopfschmerz-Risiko.Unklar, was genau den Kopfschmerz auslöst
Das ist allerdings nur eine Untersuchung über rein statistische Zusammenhänge. Warum steigende Temperaturen Kopfschmerzen bei entsprechend sensiblen Menschen begünstigen, darüber gibt die Studie keinerlei Auskunft. Es gibt zwar verschiedene Erklärungsansätze – etwa, dass die Blutgefäße im Gehirn und die Muskulatur, die diese Blutgefäße umgibt, sich nicht so schnell an den Wetterumschwung anpassen können. Aber richtig geklärt ist das bis heute nicht.Sat, 7 Oct 2023 - 01min - 5570 - Dom, Münster, Kathedrale, Basilika – Was sind die Unterschiede?
Kathedralen sind Bischofssitze
Ein Dom ist ein großes, historisch bedeutsames Kirchenhaus. Das gleiche gilt für eine Kathedrale, aber Kathedrale ist eigentlich kein architektonischer Begriff, sondern sagt nur, dass es sich bei der jeweiligen Kirche um einen katholischen, orthodoxen oder – in Großbritannien – anglikanischen Bischofssitz handelt. Kathedra ist griechisch und heißt "Sitz". Nicht jeder Dom ist also eine Kathedrale. Der Kölner Dom oder der Dom zu Speyer sind gleichzeitig Kathedralen, aber der Frankfurter Kaiserdom zum Beispiel nicht.Unterschied zwischen Dom und Münster meist regional
Jetzt zum Münster. Da steckt das Wort Monasterium drin. Also Kloster. Und das war auch die ursprüngliche Bedeutung, eineKirche mit angeschlossenem Kloster. Aber heute wird der Begriff Münster auch für andere große Stifts- und Pfarrkirchen verwendet, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Große Kirchen, die anderswo Dom heißen würden, heißen hier eher Münster. Ob eine Kirche Dom oder Münster heißt, hängt also in der Regel vor allem von der Region, nicht der Religion ab.Basilika: mindestens drei Schiffe
"Basilika" ist nun wieder ein architektonischer Begriff. Er bezieht sich auf eine bestimmte räumliche Anordnung einer Kirche, die aus dem Römischen kommt. Eine Basilika ist eine Kirche mit mindestens drei Schiffen, wobei das mittlere Schiff höher ist als die beiden seitlichen und einen eigenen Lichteinfall hat.Unabhängig von der Architektur: Basilika kann auch Ehrentitel sein
Das Wort Basilika wird aber auch vom Vatikan als Ehrentitel für bestimmte Kirchen verliehen – unabhängig davon, wie sie gebaut sind.Sat, 17 Feb 2024 - 01min - 5569 - Klimawandel: Wie können kleine Mengen CO2 in der Atmosphäre bereits das Klima erwärmen?
0,04 Prozent – das hört sich nach lächerlich wenig an. Allerdings könnte man bei Arsen, Zyankali oder Plutonium auch sagen: Die paar Gramm – was sollen die bei einem ausgewachsenen Menschen schon ausmachen? Aber wie wir wissen, sind sie tödlich. Es hilft also nicht, nur auf die absolute Menge zu schauen. Denn bestimmte Stoffe können schon in kleinen Mengen große Wirkung entfalten.
CO2 ist nicht "giftig" und hat auf Pflanzen sogar einen gewissen Düngeeffekt
Jetzt könnte man sagen: CO2 kann man nicht mit dem Gift Zyankali vergleichen, denn CO2 ist schon immer in der Luft; es gibt "nur" etwas mehr davon ... Ja, die Konzentration der Atmosphäre hat sich in den letzten 200 Jahren um etwa ein Drittel erhöht. Vergleicht man das mit einem Gift im Körper, so ist ein Drittel mehr oder weniger in der Regel nicht existenzbedrohend. Wenn jemand 0,3 Promille Alkohol im Blut gut verträgt, wird er auch bei 0,4 Promille nicht sofort tot umfallen – das entspricht ungefähr der CO2-Erhöhung, um die es geht. Trotzdem ist der Vergleich schief. Denn es geht ja nicht darum, dass CO2 giftig wäre; wir atmen es täglich ein. Und wenn sich das CO2 erhöht, ist das für die einzelnen Lebewesen überhaupt nicht bedrohlich. Es hat auf Pflanzen sogar einen gewissen Düngeeffekt – manche wachsen schneller.CO2 verhindert, dass Wärmestrahlen die Erde Richtung Weltraum verlassen
Nicht die "Giftigkeit" ist also das Problem, sondern die physikalische Wirkung des CO2: Es absorbiert bestimmte Arten von Wärmestrahlung – behält also Wärmestrahlen, die sonst die Erde Richtung Weltraum verlassen würden, auf der Erde. Und das macht die Atmosphäre eben wärmer. Zunächst ist das ja auch gut – ohne CO2 in der Atmosphäre wäre es auf der Erde viel kälter, das wäre sehr lebensfeindlich. Das Dumme ist aber: Wenn wir immer mehr CO2 in die Atmosphäre blasen, dann wird es zu warm – zumindest für die Art von Zivilisation, die die Menschheit in den letzten Jahrtausenden aufgebaut hat.Thu, 5 Jan 2023 - 02min - 5568 - Stimmt es, dass der Mount Everest nicht der höchste Berg der Welt ist?
Schildvulkane auf Hawaii
Das stimmt. Denn die größten, aktivsten Vulkane der Erde sind höher als der Mount Everest. Sie befinden sich auf Hawaii. Da ist der Mauna Loa und der Mauna Kea. Die sind beide über 10.000 Meter hoch – vom Meeresboden angerechnet bis über den Meeresspiegel. Über dem Meeresspiegel sind sie etwa 4.000 Meter hoch, aber ganz flach. Man nennt sie Schildvulkane.Wed, 6 Jul 2022 - 01min - 5567 - Wer hat wann den Teebeutel erfunden?
Missverständnis in England: Teebeutel gedacht als leichte Verpackung
Die Idee, Tee in Beutel zu packen, entstand eher zufällig. Anfang des 20. Jahrhunderts verschickten Teehändler ihren Tee meist in Blechdosen. Die waren aber schwer und teuer. Und so kam ein gewiefter Teehändler namens Thomas Sullivan auf die Idee, den Tee in kleine Stoffsäckchen zu packen und zu verschicken.Die Kunden dachten, dass man diesen Tee in Mullsäckchen einfach in Teegläsern mit heißem Wasser aufkochen könnte, ohne daran zu denken, den Tee aus diesen Mullsäckchen rauszunehmen. So entstand die Idee des Teebeutels.
So erzählt es die Leiterin des Ostfriesischen Teemuseums Mirjana Ćulibrk. 1903 wurde schon das erste Patent auf kleine Tee-Baumwollsäckchen in den USA anmeldet.Quelle: Mirjana Ćulibrk, Leiterin Ostfriesisches Teemuseum
Heißgetränk für Soldaten: Deutsches Tee-Handelshaus portioniert im Ersten Weltkrieg
Doch zur Industriereife brachte sie nicht etwa die Engländer, sondern das Dresdner Handelshaus Teekanne. Anlass ist diesmal der Erste Weltkrieg. Um den Tee für die Soldaten an der Front zu portionieren, verpackt ihn Teekanne in kleine handgenähte Mullsäckchen. Die Soldaten konnten sie ins heiße Wasser fallen lassen, das sich anschließend rund um den Beutel tiefbraun zu färben begann. Deshalb nannten sie die Beutel auch gerne "Teebombe". Geschmeckt hat der Tee nicht besonders, weil sich aus den Stoffbeuteln heraus das Aroma nicht gut entfalten konnte, dafür aber die Mullbeutel ihr eigenes Aroma ins Wasser abgaben.Adolf Rambold erfindet den Doppelkammerbeutel
Doch 1924 kam Adolf Rambold in die Firma. Bis 1929 entwickelte er die erste Teebeutelpackmaschine; seine Teebeutel waren aus geschmacksneutralem Pergament. Schon damals entwickelt er auch die noch heute am meisten verbreiteten zweigeteilten "Doppelkammerbeutel", in denen sich das Aroma besonders gut entfalten kann. Andere Formen wie die tetraederförmigen Pyramidenbeutel kamen erst viel später dazu.Thu, 21 Dec 2023 - 01min - 5566 - An welchem Tag haben die meisten Menschen Geburtstag?
Tendenz: Frühherbst
Ich habe drei Statistiken gefunden, zwei aus den USA und eine aus Österreich: Schon die Zahlen aus den USA widersprechen sich ein wenig. Zum einen gab es die Statistik der (inzwischen eingestellten) Internetseite anybirthday.com. Das war eine Seite, die man u. a. als Erinnerungskalender nutzen konnte, um Geburtstage von Freunden und Angehörigen nicht zu vergessen. Nach der Statistik dieser Seite ist der Rekordhalter der 5. Oktober. Diese Daten beruhen allerdings auf freiwilligen Angaben von Millionen von Nutzern. Daneben hat die New York Times eine Statistik der Geburten zwischen 1973 und 1999 veröffentlicht. Dort stand der 16. September auf Platz 1. Nach der österreichischen Studie – sie beruht auf amtlichen Zahlen – gibt es ebenfalls eine Häufung von Geburten im frühen Herbst. Allerdings ist da der häufigste Geburtstag am 22. September.Weihnachtszeit inspiriert möglicherweise zur Familiengründung
Auf jeden Fall zeigen die Zahlen sehr schön einen Anstieg bei den Geburten zwischen Juli und Oktober. Und Ende September/Anfang Oktober kommen bis zu 15 Prozent mehr Kinder auf die Welt als im Jahresdurchschnitt. Wenn wir 9 Monate zurückzurechnen, stellen wir fest, dass diese Kinder vor allem in den Weihnachtsferien gezeugt wurden. Wenn man es noch genauer macht und die Durchschnittsdauer einer Schwangerschaft von 266 Tagen ansetzt, landet man ausgehend vom 22. September ziemlich genau bei Neujahr. Nun kann man spekulieren, ob an diesem Tag viele Menschen schon einen ersten guten Vorsatz fürs neue Jahr umsetzen wollen oder ob generell die Weihnachtszeit eine überdurchschnittliche Zahl von Leuten zur Familiengründung inspiriert. Was die Geburten in Deutschland betrifft, weist das statistische Bundesamt nur eine Monatskurve aus – der Trend ist ähnlich. Anmerkung zur Grafik: Die Zahl 1.000 für den Jahresdurchschnitt bedeutet nicht, dass im Schnitt 1.000 Kinder pro Tag geboren werden. Vielmehr dient die Zahl der Vergleichbarkeit – die Bevölkerung und damit die Geburten schwanken ja von Jahr zu Jahr. Deshalb wurden jeweils die Geburtenzahlen jedes Jahres auf "1.000" heruntergerechnet, um die Häufigkeiten vergleichbar zu machen. Die Kurve verdeutlicht auch sehr schön, dass sich die Kurven über die Jahre verändern. Früher in der Zeit vor der Pille sind in Deutschland die meisten Kinder noch im März/April geboren worden. Man könnte sie als Produkte von starken "Frühlingsgefühlen" im Vorjahr deuten. Zwar gab es auch damals schon eine zweite kleine Spitze im September, aber erst in den letzten Jahrzehnten wurde der September zum geburtenstärksten Monat.Wed, 20 Dec 2023 - 02min - 5565 - Warum werden Haare grau?
Melanin wird in speziellen Zellen der Haarwurzel gebildet. Mit zunehmendem Alter produziert die Haarwurzel immer weniger davon und irgendwann stell sie die Melaninproduktion ganz ein. In welchem Alter das passiert, ist stark genetisch bedingt.
Wodurch entsteht die graue oder weiße Haarfarbe, wenn keine Farbpigmente mehr in den Haaren enthalten sind?
Graue Haare sind tatsächlich nur eine optische Täuschung. Einzelne graue Haare gibt es an sich gar nicht, denn sobald die Haarwurzel keine Pigmente mehr produziert, sind Haare farblos und erscheinen weiß. Anstelle der Pigmente werden nämlich winzige Sauerstoffbläschen im Haar eingelagert. Diese Bläschen streuen das Licht; dadurch sehen Haare weiß aus. Wenn aber zwischen den weißen Haaren noch farbige Haare auf dem Kopf sind und durchscheinen, wirkt das Haar in seiner Gesamtheit grau oder silbrig.Der Mythos vom "grauen Haar über Nacht"
Der Mythos "graue Haare über Nacht" durch ganz viel Stress stimmt nicht. Zum einen passiert das nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach, Zelle für Zelle. Und selbst wenn Haarzellen plötzlich die Farbstoffproduktion einstellen, dauert es ja Monate, bis die dann farblosen Haare rausgewachsen sind. Es gibt aber tatsächlich Forschung dazu, inwiefern Stress und graue Haare zusammenhängen. In einer kleinen US-amerikanischen Studie wurde gezeigt, dass graue Haare, die während einer stressigen Phase entstanden sind, bei Entspannung wieder zu ihrer ursprünglichen Farbe zurückkehren können. Wir können uns das bildlich an einem Haar vorstellen, das unten ein paar Zentimeter braun ist, dann einige Zentimeter grau und am Ansatz wieder farbig. Derzeit ist es nicht möglich, komplett zu verhindern, dass Zellen altern. Das sagt auch die Forschung: Ein 70-Jähriger bekommt durch Entspannung nicht plötzlich wieder die alte Haarfarbe. Früher oder später werden alle Haare grau und dieser Prozess lässt sich dann – nach jetzigem Kenntnisstand – auch nicht mehr umkehren.Gibt es Ideen, wie man das umkehren könnte?
Dazu gibt es Forschung aus den USA. Ein Forschungsteam hat z. B. die Vermutung, dass die Haare nicht deshalb ausbleichen, weil die Farbzellen keinen Farbstoff mehr produzieren, sondern weil gar keine Farbzellen an sich da sind. Die müssen nämlich erstmal aus sogenannten Stammzellen entstehen und in die Haarwurzel wandern. Und das funktioniert irgendwann wohl nicht mehr so gut. Wenn man diese Bewegung wieder anregen könnte, wäre es vielleicht möglich, das Ergrauen rückgängig zu machen. Damit das aber wirklich funktioniert, ist noch eine Menge Forschung nötig.Tue, 19 Dec 2023 - 02min - 5564 - Ist das Gedächtnis ein Muskel?
Gehirn: eine Art Muskelapparat, der sich trainieren lässt
Das Gedächtnis ist eine Art Muskelapparat, also nicht ein Muskel, sondern ein gesamter Apparat unserer Muskulatur. Und der lässt sich tatsächlich trainieren: Das, was man viel verwendet und einsetzt, wird besser.Konzentrationsvermögen ist von zentraler Bedeutung
Es gibt einen zweiten wichtigen Aspekt: Unser Konzentrationsvermögen als Eingangspforte dessen, was wir überhaupt an Informationen prozessieren. Das ist von herausragender Bedeutung. Wann immer man sein Konzentrationsvermögen trainiert – zum Beispiel, indem man Routinen und Gewohnheiten mal ändert, auch ein Buch lesen gehört dazu, sich länger auf eine Aufgabe konzentrieren – trainiert man genau diesen Bereich, der im Alter schlechter werden kann und der so wichtig für Lernen und Gedächtnis ist. Denn nur, wenn wir uns hinlänglich lange auf eine Aufgabe konzentrieren, können wir dieses Wissen abspeichern und langfristig wieder abrufen.Thu, 14 Dec 2023 - 01min - 5563 - Warum können Stare andere Vögel nachahmen?
Wenn Stare "spotten"
Wenn Stare Laute bei anderen Vögeln hören, die ihnen gefallen, imitieren sie diese Laute. Man nennt das "spotten". Man kennt das auch von zahmen Vögeln, denen man in der Gefangenschaft etwas vorgepfiffen hat, was sie dann nachahmten. Genauso wie Papageien es lernen können, die menschliche Sprache zu imitieren oder zu pfeifen, so beobachtet man das z.B. auch beim Dompfaff bzw. dem Gimpel.Syrinx ist bei Singvögeln besondes ausgebildet
Allerdings sind dazu nicht alle Vögel in der Lage. Die Singvögel aber haben eine besonders ausgebildete Syrinx; das ist der Singmuskelapparat, also eine Art Kehlkopf. Vögel haben ja zwei Kehlköpfe – die sogenannte Syrinx und den Larynx. Der Larynx ist dazu da, zischende, rauschende und kratzende Geräusche zu erzeugen. Das hört man z.B. bei Birkhühnern, wenn sie „schschschschsch“ machen und ähnliches. Die Syrinx ist ein Singmuskelapparat, mit dem die einzelnen Laute erzeugt werden. Einige Vögel haben eine besonders komplizierte Syrinx und können alles Mögliche imitieren; zu diesen Vögeln gehören insbesondere die Stare.Fri, 27 May 2022 - 01min - 5562 - Seit wann gibt es Adventskränze?
Zu diesem Thema findet man immer wieder falsche Erklärungen: Der Adventskranz habe etwas mit dem Lebensrad zu tun und sei ein uraltes Symbol. Das ist nicht richtig. Der Adventskranz ist, gemessen an anderen Bräuchen, ganz jung; und man kennt sogar seinen Erfinder.
Der erste Adventskranz hing in einem Hamburger Heim für Jugendliche
Es handelt sich um den evangelischen Pastor Johann Hinrich Wichern, der sehr stark in der christlichen Soziallehre verankert war und sich – typisch für das 19. Jahrhundert – besonders für Kinder engagierte, die in benachteiligten sozialen Verhältnissen lebten. Wichern hängte Mitte des 19. Jahrhunderts den allerersten Adventskranz im "Rauhen Haus" in Hamburg auf – einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche. Dieser Kranz hatte zunächst noch 24 Kerzen, für jeden Dezembertag eine. Später hat Wichern dieses System dann vereinfacht und auf die vier Sonntage reduziert.Adventskranz hat klare pädagogische Funktion: Zeit sichtbar machen
Die Visualisierung von Zeit ist für Kinder besonders wichtig, denn die können sich unter "vier Wochen" nichts vorstellen. Man muss Kindern vor Weihnachten sagen: Du musst noch so und so oft schlafen, dann kommt das Christkind. – Wenn sie das an Kerzen abzählen können, ist die Zeit bis Weihnachten für sie viel besser erkennbar. Zum Adventskranz gehört darüber hinaus noch eine zweite Visualisierung der Zeit, die übrigens ebenfalls eine evangelische Erfindung ist: der Adventskalender. Der evangelische Pastorensohn Lang entwickelte kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert den ersten Adventskalender. Anfangs waren das noch Bilder zum Aufkleben, später erfand er selbst bereits die Türchenform, wie wir sie heute noch kennen. All das dient dazu, die Zeit bis Weihnachten sichtbar zu machen, den Advent, die "Ankunft", zu visualisieren.Sun, 3 Dec 2023 - 01min - 5561 - Warum kann eine Reizblase in den Wechseljahren auftreten?
Östrogen regelt das Funktionieren von Scheide und Blase
Man muss sich vorstellen, dass sowohl die Scheide als auch die Blase abhängig sind vom Hormon. Östradiol ist gut für die Scheide, aber es ist auch sehr gut für die Blase. Das Funktionieren von Scheide und Blase, der Schutz vor Infektionen, der Schutz vor diesem Reizgefühl geht eigentlich nur, wenn genug Östradiol da ist bzw. Östrogene da sind, um genau zu sein. Es muss gar nicht Östradiol sein, es kann auch Östriol sein. Es muss einfach genug Östrogen da sein.80 Prozent der Frauen bekommen Beschwerden
Das Dramatische ist: Dieses Problem haben 100 Prozent aller Frauen. Also nicht alle Frauen kriegen eine Reizblase, aber alle haben diesen niedrigen Östradiolspiegel, diese niedrigen Östrogene, die sich dann auswirken. Und ungefähr 80 Prozent haben Beschwerden. Aber es wird nur ein ganz kleiner Teil der Frauen behandelt.Mon, 23 Oct 2023 - 01min - 5560 - Warum zucken wir manchmal mit dem Auge?
Augenzucken: keine Gefahr, aber ein Warnzeichen
Das kann verschiedene Gründe haben, und es ist nicht immer so leicht zu erkennen, woran es genau liegt. Normalerweise zuckt nur das rechte oder linke Auge, und dann auch nur das obere oder untere Augenlid. Auch wenn es für andere oft gar nicht zu sehen ist, kann es sich unangenehm anfühlen.Was können die Ursachen sein?
Möglichkeit 1 ist Stress! Wenn wir gestresst sind, dann können unsere Muskeln verkrampfen. Und das Augenlid ist ein besonders empfindlicher Muskel. Wenn es müde ist, dann fängt es an zu zucken. Genauso ist auch der Kiefer angespannt, wenn es uns psychisch nicht so gut geht. Diese Anspannung überträgt sich auf das Augenlid. Wenn wir dann noch zu wenig schlafen, bekommen die Augen keine Pause und sind erschöpft. Das kann auch bei einer unerkannten Sehschwäche so sein oder nach einer Operation an den Augen. Dann sind die Muskeln rund um unser Auge viel stärker belastet als normalerweise und fangen an zu zucken.Zu viel Kaffee und zu wenig Vitamine
Die zweite Möglichkeit ist, dass das Zucken am Auge eine Mangelerscheinung ist. Muskelkrämpfe entstehen nämlich durch fehlende Stoffe im Körper. Wenn sich jemand vegan ernährt, kann das zum Beispiel zu einem Vitamin-B12-Mangel führen. Während einer Schwangerschaft benötigt der Körper dagegen mehr Magnesium als sonst. Wenn der Körper zu wenig von einem der beiden Stoffe bekommt, können Muskeln anfangen, unkontrolliert zu zucken. Auch gereizte und trockene Augen bei Allergien oder nach viel Zeit an einem Bildschirm können ein Grund sein. Außerdem sind Menschen, die viel Kaffee trinken oder rauchen, häufiger von Augenzucken betroffen, weil der Körper durch Koffein und Nikotin schlechter durchblutet wird.Muss man sich Sorgen machen, wenn die Augen zucken?
Meistens hört das Zucken schnell wieder auf und ist ungefährlich. Nur wenn das Auge sehr häufig zuckt oder sogar entzündet ist, sollte man zum Arzt gehen. Ein möglicher Grund dafür könnte nämlich ein Fremdkörper im Auge sein. Auch wenn ein zuckendes Auge also nicht unbedingt gefährlich ist, kann es vor anderen kleineren Problemen warnen.Wed, 27 Sep 2023 - 02min - 5559 - Beeinflusst die Darmflora das Schmerzempfinden?
Kotspende: Fremdbakterien in den Darm einsetzen
Hier geht es um das sogenannten Mikrobiom. Wir wissen, dass unsere Nahrung durchaus auf die Darmflora einwirkt. Die Darmflora bildet Bakterien und Stoffe, die unsere Stimmung beeinflussen. Die gelangen ist Gehirn und senken oder verbessern unsere Stimmung. Diese Erkenntnis ist sehr aufregend. Derzeit sammeln wir Erfahrungen mit der Substitution durch Implantation von Bakterien von Spendern, z.B. nach einer Antibiotika-Therapie oder einer Darmentzündung. Die Fremdbakterien werden in den entleerten Darm eingesetzt. Das klingt zwar abstrus, aber durch eine Kotspende wird versucht, die Darmflora wieder aufzubauen. Die Erfolge sind überraschend gut. Was ich daran so spannend finde ist, dass man dadurch sieht, dass die Nahrung und damit die Darmflora Einfluss auf unsere Stimmung über unser Gehirn nehmen kann.Nimmt die Darmflora Einfluss darauf, wie stark Schmerz empfunden wird?
Wenn klar ist, dass die Psyche eine große Rolle dabei spielt, wie wir Schmerzen empfinden, wie belastend er ist, wie viel Angst er macht, dann hängt das natürlich schon von unserer Stimmung ab. Wenn Sie froh gestimmt sind, erleben Sie Schmerz ganz anders, als wenn Sie depressiv oder ängstlich sind. Das weiß jeder Sportler: Wenn er gut drauf ist, hält er schmerzhafte Situationen leichter aus. Und wenn es ihm schlecht geht, dann tut alles weh. Das kennt jeder aus der eigenen Erfahrung. Es gibt Tage, an denen alles mies und schlecht erscheint. Das kann von solchen Dingen auch abhängen. Das zeigen die neuen Untersuchungen. Diese ehemals obskure Annahme betrachtet man heute wissenschaftlich und bezieht sie mit ein.Sun, 20 Jun 2021 - 02min - 5558 - Sind die Hormone bei einer Hormonersatztherapie pflanzlich oder chemisch?
Pharmaindustrie setzt Grundstoffe aus der Natur ein
Die sind auf jeden Fall erst einmal pharmazeutisch hergestellt. Was viele Leute gar nicht wissen: Die Pharmaindustrie bedient sich in vielen Fällen eines Tricks. Sie nimmt nämlich Grundstoffe aus der Natur. Dann muss man keine Vollsynthese machen. Wenn ich zum Beispiel Rotklee nehme oder Traubensilberkerze, dann ist das kein Östradiol; es hat eine chemisch andere Struktur. Aber es kann auch mit dem Östrogenrezeptor in Interaktion treten.Yamswurzel ersetzt keinesfalls Progesteron
Eine kleine Anekdote: Ich hatte mal die Gelegenheit, Carl Djerassi (1923 - 2015) kennenzulernen, den Erfinder der Pille,. Dem verdanken wir eigentlich auch die Hormontherapie. Ich habe ihn gefragt, warum so viele Menschen Yamswurzel nehmen. Da wurde er ganz aufgeregt, nahm einen Zettel heraus und kritzelte wild Strukturformeln darauf. Dann sagte er: "Wissen Sie, wenn Sie Yamswurzel mögen, dann können Sie die essen. Aber Progesteron wird da ganz sicher nicht draus. Das kann Ihr Körper nicht. Dafür brauchen Sie die pharmazeutische Industrie." – Das fand ich ungemein lehrreich. Bestimmte pflanzliche Präparate haben also eine schwache östrogenartige Wirkung. Aber die Yamswurzel ersetzt auf keinen Fall Progesteron.Wed, 18 Oct 2023 - 01min - 5557 - Was ist das Münchhausen-Syndrom?
Münchhausen-Syndrom: Ärztehopping mit erfundenen Leiden
Wer krank ist, tut normalerweise alles dafür, schnell wieder gesund zu werden. Bei Menschen mit dem Münchhausen-Syndrom ist es genau umgekehrt: Sie wollen krank sein und ziehen mit erfundenen Leiden durch die Arztpraxen. Um glaubwürdig zu wirken, verletzen sie sich auch selbst; schlucken giftige Substanzen oder sorgen dafür, dass Wunden sich immer wieder infizieren. Sie haben also echte, teils bedrohliche Symptome – und werden daher oft mit großem medizinischem Aufwand behandelt; bis hin zu komplizierten Operationen. Für Ärztinnen und Ärzte ist es kaum möglich, diese Krankheits-Hochstapler zu erkennen. Denn körperlich geht es ihnen ja tatsächlich schlecht. Und wenn doch mal jemand Verdacht schöpft, verschwinden Patienten mit Münchhausen-Syndrom und bitten einfach anderswo um Behandlung. Ständiges Ärztehopping gehört zum Krankheitsbild.Unterschied zu Simulanten: Finanzielle Vorteile sind nicht das Ziel
Es gibt einen wichtigen Unterschied zu Simulanten: Die täuschen auch Krankheiten vor. Aber Simulanten tun es nur, weil sie sich davon zum Beispiel finanzielle Vorteile versprechen. Psychisch sind sie gesund.Schwere psychische Störung mit zwanghaftem Lügen
Das Münchhausen-Syndrom ist dagegen eine schwere psychische Störung. Betroffen sind überwiegend Männer. Sie leiden oft auch unter Narzissmus oder Borderline-Störungen und sind unfähig zu engen Bindungen. Zwanghaftes Lügen gehört für sie in allen Bereichen zum Alltag. Psychotherapie könnte helfen, aber dazu sind Betroffene fast nie bereit.Mon, 27 Nov 2023 - 01min - 5556 - Kehren Vögel an die alte "Adresse" zurück?
Da gibt es momentan noch Unsicherheiten. Wir setzen aber große Hoffnung in das globale Beobachtungssystem, das wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickeln. Wenn das in zwei Jahren an der Internationalen Raumstation sitzt, können wir zum ersten Mal weltweit und auf dem ganze Zug eine Schwalbe beobachten. Dann können wir herausfinden, wohin die Schwalben gehen, die eben nicht mehr zurückkommen. Das ist für den Schutz der Tiere sehr wichtig, weil wir dann zum ersten Mal verstehen: Was passiert denen? Bleiben sie irgendwo über dem Mittelmeer in einem schlechten Wetter hängen und stürzen ab? Kommen sie nicht über die Sahara? Sind die Insekten im Sudan nicht mehr da oder werden die irgendwie Pestizid behandelt? Was passiert den Schwalben wirklich?
Gibt es Vögel, die immer zum selben Nistkasten zurückkehren?
Ja. Es ist sehr spannend, wie die den wiederfinden. Wir haben bereits einige Hinweise darauf, wie diese Navigation zwischen Kontinenten Jahr für Jahr funktionieren kann. Es ist faszinierend, dass eine Schwalbe zum selben Nest zurückkehrt und zwischendurch in Südafrika war. SWR 2014Tue, 14 Mar 2023 - 02min - 5555 - Wie viele verschiedene Gerüche können wir wahrnehmen?
"Riechalphabet" hat 350 Buchstaben
Eigentlich unendlich viele. Sie können sich das wie ein Alphabet vorstellen. Das heißt, das Riechalphabet hat 350 Buchstaben und sie können aus diesen 350 Zelltypen 350 verschiedene Kombinationen machen. Lange Wörter mit 100 Buchstaben oder welche mit nur zehn Buchstaben und jeden Buchstaben durchmischen. Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten.Fri, 11 Jun 2021 - 00min - 5554 - Wie viel Aberglaube steckt in Ritualen von Sportlern?
Magisches Denken und kindliche Allmachtsfantasie
Da spielt eine Art von magischem Denken mit rein. Man könnte es Aberglauben nennen, aber ich mag den Begriff „magisches Denken“ lieber. Darin steckt etwas sehr Kindliches nämlich dass ich selbst der Mittelpunkt der Welt bin und alles mit meinem Verhalten beeinflusse. Und wenn ich morgens beim Bäcker nicht mein Rosinenbrötchen mit dem Schokoguss gekriegt habe, weil das gerade aus war, dann ist vollkommen klar, dass am Nachmittag im Stadion meine Mannschaft nicht gewinnen kann. Dass man alles auf ich selbst und seine persönlichen Rituale bezieht – dahinter steckt eine Art von Allmachtsfantasie. Kinder haben in einer bestimmten Entwicklungsphase genau diese Allmachtsfantasien und beziehen alles auf sich. Das ist in dieser Phase auch richtig und wichtig. Aber irgendwann muss man da rauskommen, denn sonst ist es ein magisches Denken und ein Aberglaube, der irgendwann auch krankhaft wird.Thu, 10 Jun 2021 - 01min - 5553 - Wann ist Israelkritik antisemitisch?
Kritik an konkreten Handlungen ist legitim
Wie jede Regierung, so muss sich die israelische Regierung Kritik gefallen lassen – von der Opposition im eigenen Land und ebenso vom Ausland. Auch die Bundesregierung kritisiert die israelische Politik immer wieder mal, trotz des, historisch bedingt, besonderen Verhältnisses zum jüdischen Staat. Der entscheidende Punkt ist: Diese Kritik bezieht sich auf konkrete Entscheidungen oder Handlungen der israelischen Regierung. Etwa auf den jüdischen Siedlungsbau in der Westbank, der auch aus deutscher Sicht völkerrechtswidrig ist. Oder wenn es Pläne gibt, die Unabhängigkeit der Justiz zu beschränken. Solche konkrete Kritik ist völlig legitim. Auch wenn sich Israel gegen Terror aus dem Gazastreifen mit massiven Gegenangriffen wehrt, ist es legitim, die Frage nach der Verhältnismäßigkeit zu stellen – egal, wie man sie dann für sich beantwortet.3-D-Regel zur Überprüfung: Wann ist Israelkritik antisemitisch?
Doch es gibt bestimmte Argumentationsmuster, bei denen Israelkritik antisemitische Züge bekommt. Als Faustregel gilt dabei die sogenannte 3-D-Regel. Der israelische Politiker Natan Scharanski hat sie entwickelt. Die drei D stehen für Doppelstandards, Dämonisierung und Delegitimierung. Wenn Israelkritik eins dieser drei Merkmale enthält, dann gilt sie nach dieser Regel als antisemitisch.Doppelstandards: Von Israel mehr erwarten als von anderen
Doppelstandards bedeutet, dass Israel politisch-moralisch mit anderen Maßstäben gemessen wird als andere Staaten. Wenn Israel in der Kritik viel schlimmer erscheint als andere Regierungen, denen man ihre Menschenrechtsverletzungen durchgehen lässt. Schlimmer als Diktaturen, die Oppositionelle umbringen lassen. Schlimmer als ein Terrorregime, das wahllos Zivilisten ermordet oder Frauen ein selbstbestimmtes Leben verweigert. Kurz: Wenn man von Israel Dinge erwartet, die man von anderen nicht erwartet, dann ist das nach der 3-D-Regel ein guter Anhaltspunkt zu sagen: Die Kritik ist antisemitisch, denn sie wendet doppelte Standards an. Dafür steht das erste D.Dämonisierung: Israel als "teuflische Macht" und "Grundübel"
Das zweite D steht für Dämonisierung. Wenn Israel als teuflische Macht dargestellt wird, als das Grundübel schlechthin, dann ist das keine Kritik mehr, die sich auf konkrete Politik bezieht. Auch wenn Israel mit dem NS-Regime gleichgesetzt wird, ist nicht nur der Vergleich historisch absurd (zur Erinnerung: Die Nazis haben in Vernichtungslagern Millionen Menschen systematisch ermordet, haben den 2. Weltkrieg angefangen und duldeten keinerlei Opposition). Ein solcher Vergleich zielt ausschließlich darauf ab, das Land zu dämonisieren (und nebenbei den Holocaust zu relativieren). Manchmal erscheint Israel auch als böser Akteur in irgendwelchen Verschwörungserzählungen. Das ist dann immer ein Hinweis darauf, dass sich Leute auf Israel als Hassobjekt fixieren – was dann eben Hass ist und keine Kritik. Natürlich könnten sich Menschen, die diesen Verschwörungserzählungen anhängen, auf den Standpunkt stellen, sie haben nichts gegen Juden, aber sie dürften doch wohl die angebliche Wahrheit über Israel sagen. Die Frage, die sich diese Leute meist nicht stellen: Warum glauben sie oder beschäftigen sie sich mit solchen Verschwörungstheorien genau dann, wenn sie mit Israel zu tun haben? Warum hört man nie Verschwörungstheorien über Österreich oder Island? Diese Fixierung auf Israel als jüdischem Staat gilt deshalb als starkes Indiz für antisemitische Prägung, auch wenn sie den Betroffenen selbst nicht bewusst sein mag.Delegitimierung: Existenzberechtigung Israels infrage stellen
Das dritte D steht für Delegitimierung. Dazu ein Vergleich: Viele kritisieren die Politik der Bundesregierung – aber kaum jemand stellt deshalb Deutschland als Staat infrage oder sieht sich als "Deutschland-Kritiker". Manche Israelkritik läuft aber darauf hinaus, Israel als Staat die Legitimation abzusprechen – als hätte das Land keine Existenzberechtigung. Dies ist aber historisch und völkerrechtlich schlicht falsch. Und tatsächlich gibt es Formen von Israelkritik, die vielleicht nicht explizit sagen, dass Israel kein Existenzrecht hat, die aber im Ergebnis darauf hinauslaufen. Wenn Israel Ziele der Hamas oder der Hisbollah angreift, kann man immer diskutieren, ob das im konkreten Fall zielführend und verhältnismäßig ist. Aber wer Israel grundsätzlich dafür verurteilt, dass es versucht, sich gegen Angriffe wirksam zu verteidigen, stellt indirekt das Existenzrecht des jüdischen Staats infrage. Das sind also die drei D: Doppelstandards, Dämonisierung und Delegitimierung. – Viele offizielle Stellen haben diese Kriterien übernommen, als Anhaltspunkte dafür, wo hinter vermeintlicher Israelkritik eine antisemitische Einstellung erkennbar ist.Antisemitismus: Einstellung, die alles Jüdische negativ bewertet
Antisemitismus, verstanden als eine Einstellung, die alles Jüdische negativ bewertet oder zumindest mit einem Vorbehalt versieht. Seien es die Juden als Kollektiv oder auch jüdische Einrichtungen von der Synagoge bis zum Staat Israel. Nach diesem Verständnis ist es deshalb auch antisemitisch, wenn Juden in Deutschland für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden. Auch an diesem Punkt handelt es sich nicht mehr um normale Israelkritik, sondern um eine antisemitische Gleichsetzung völlig verschiedener Gruppen, deren Gemeinsamkeit primär im Jüdischsein besteht.Ob ein Mensch Antisemit ist, ist schwer zu belegen
In öffentlichen Debatten geht es oft heiß her und da wird schnell mal jemandem nach einer bestimmten Äußerung Antisemitismus vorgeworfen. Dabei empfiehlt es sich jedoch, zu unterscheiden zwischen der Äußerung und der Person. Ob jemand als Mensch ein Antisemit ist oder eine Antisemitin, ist ein sehr weitgehender Vorwurf und meist schwer zu belegen.Zum einen ist es immer schwierig, in die Köpfe von Menschen hineinzuschauen und zu erkennen, was sie wirklich denken. Zum anderen gibt es Menschen, die sich wirklich nicht als Antisemiten sehen. Doch plötzlich rutscht ihnen eine Bemerkung heraus, die einen antisemitischen Inhalt transportiert, weil sie das vielleicht selbst irgendwo aufgeschnappt haben. Zu diskutieren, ob jemand in Wahrheit Antisemit ist oder nicht, hilft in der Diskussion oft nicht weiter, zumal die Diskussion dann schnell sehr persönlich wird. Aber festzustellen, dass eine Äußerung antisemitisch ist – dafür gibt es klare Indizien wie eben die 3-D-Regel.Grenzen der 3-D-Regel
Aber auch bei dieser Regel bleiben manchmal Unsicherheiten: Nehmen wir eine gebürtigen Palästinenserin, die von der israelischen Politik unmittelbar betroffen ist – die vielleicht im Westjordanland den israelischen Siedlungsbau erlebt oder deren Angehörige in Gaza bei einem israelischen Angriff ums Leben kamen. Aufgrund ihrer persönlichen Betroffenheit ist sie auf Israel schlecht zu sprechen, während sie sich für die Menschenrechtsverletzungen Chinas, Russlands oder der Taliban weniger interessiert. Von außen betrachtet, wendet sie also doppelte Standards an und so könnte man ihr streng nach der 3-D-Regel Antisemitismus vorwerfen. Nur wird damit ihr Verhalten nicht angemessen eingeordnet. Eindeutiger wird es dagegen, wenn sie in Deutschland vor einer Synagoge demonstriert, eine israelische Fahne verbrennt oder Morde an jüdischen Zivilisten bejubelt – das ist dann Antisemitismus in Reinkultur.Fri, 16 Feb 2024 - 06min - 5552 - Was hilft Brustkrebs-Patientinnen in den Wechseljahren?
Brustkrebsmedikamente können große Beschwerden hervorrufen
Wir sehen sehr viele Frauen mit Brustkrebs, die erhebliche Beschwerden haben, zum Teil ausgelöst durch Tamoxifen oder das andere wichtige Medikament, das eingesetzt wird: der Aromatasehemmer. Beide haben das Ziel, dass möglichst wenig Östrogen da ist, um einen hormonabhängigen Tumor in seinem Wachstum zu fördern bzw. um sicherzustellen, dass sie möglichst kein Rezidiv ihrer Erkrankung bekommen. Ein typisches Problemen von Frauen, die diese Medikamente bekommen ist, dass sie starke Hitzewallungen, klimakterische Symptome bekommen. In so einer Situation kann man zum Beispiel bestimmte Antidepressiva einsetzen. Man kann auch bestimmte Antiepileptika oder Verhaltenstherapie einsetzen. Damit habe ich selbst aber nicht viel Erfahrung, ich bin Hormondoktorin. Aber mit den anderen Sachen habe ich viel Erfahrung.Fezolinetant — der erhoffte Gamechanger?
Es gibt jetzt etwas tolles Neues, eine spannende neue Substanz. Wir sind frohgemut, dass die wahrscheinlich demnächst, im Verlauf der nächsten Monate, in Deutschland auf den Markt kommen wird. Die Substanz heißt Fezolinetant – ein sogenannter NK3-Inhibitor. Die Substanz verhindert direkt im Gehirn das Entstehen von Hitzewallungen. Das ist, als würde ein Traum wahr. Wir benutzen in der Gynäkologie dauernd den Begriff Gamechanger, aber das verändert wirklich ganz viel. Zehn Prozent aller Frauen in Deutschland bekommen Brustkrebs. Die können keine Hormone nehmen. Aber die haben natürlich auch Beschwerden. Und diesen Frauen werden wir demnächst was anbieten können und auch allen anderen, die aus irgendwelchen Gründen keine Hormone nehmen können oder wollen. Die Substanz ist schon von der EMA geprüft und die haben gesagt: jawohl, ist alles prima. – Jetzt muss das noch in Deutschland zu Ende verhandelt werden. Aber sieht extrem gut aus. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir demnächst in der Lage sein werden, Patientinnen etwas effektiv Wirksames anbieten zu können. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Stand: Oktober 2023Mon, 13 Nov 2023 - 02min - 5551 - Wie wirkt sich der Östrogen-Mangel in den Wechseljahren aus?
Hitzewallungen und Nachtschweiß
Das sind die klassischen Beschwerden wie Hitzewallungen und Schweißausbrüche, aber auch Gelenkbeschwerden. Viele Frauen stehen morgen auf und stellen fest, dass es in den Gelenken zwickt und sie sich nicht mehr so bewegen können wie bisher. Das kann am Hormonmangel liegen. Wir wissen, dass die Hitzewallungen und der Nachtscheiß hervorragend auf eine Hormontherapie ansprechen. Das steht gar nicht mehr zur Diskussion.Vorsicht Osteoporose: Knochen brauchen Östrogene
Was viele nicht wissen: Auch der Knochen braucht Östrogene. Wenn die abfallen, besteht die Gefahr, dass man im Verlauf des weiteren Lebens eine Osteoporose entwickelt. Damit verbunden ist die Gefahr von Knochenbrüchen. Auch da kann die Hormonersatztherapie viel Gutes bewirken.Wed, 18 Oct 2023 - 00min - 5550 - Warum schließen wir beim Niesen die Augen?
Zusammenkneifen der Augen beim Niesen ist ein Reflex
Vermutlich, damit keine Krankheitserreger in die Augen gelangen. Es ist schwierig nachzuweisen, warum sich in der Evolution bestimmte Dinge entwickelt haben. Denn die Evolution ist ja kein denkendes Wesen, ist kein Ingenieur, den man fragen kann, was er sich bei einer bestimmten Vorrichtung gedacht hat. Man kann davon ausgehen: Dass wir die Augen beim Niesen reflexhaft zusammenkneifen – gar nicht anders können – hat sich sicher nicht ohne Grund so entwickelt.Zwei mögliche Erklärungen
Was aber ist der Nutzen heute? Vor allem zwei Gründe werden immer wieder diskutiert:- Beim Niesen entsteht ein enormer Druck. Um diesem Druck entgegenzuwirken, schließen wir die Augen. Wir würden damit sozusagen verhindern, dass die Augäpfel aus der Augenhöhle gedrückt werden. Die meisten Experten halten diese Erklärung allerdings für ziemlich unwahrscheinlich. Denn die Augen sind zwar mit den Atemwegen verbunden, allerdings nur über den schmalen Tränenkanal; über den kann dieser Druck gar nicht so schnell ans Auge abgeführt werden. Das Zukneifen der Augen verhindert, dass Krankheitserreger, die wir herausniesen, in die Augen gelangen. Diese Erklärung halten die meisten Experten für plausibler.
Sat, 16 Mar 2024 - 01min - 5549 - Warum müssen manche Menschen niesen, wenn sie in die Sonne schauen?
Photischer Niesreflex: Ein Viertel der Menschen sind Sonnennieser
Photischer Niesreflex heißt diese Eigenschaft in der Fachsprache. Es ist nur eine Minderheit – etwa ein Viertel aller Menschen – die davon betroffen ist. Ob man dazugehört, ist offenbar sehr stark genetisch bedingt. Vor einigen Jahren haben US-Forscher gezeigt, dass es zwei Genvarianten gibt, die darüber entscheiden, ob man ein Sonnennieser ist oder nicht. Das ist eine Eigenschaft ähnlich wie die Fähigkeit, Spargelgeruch im Urin zu riechen – auch dafür sind bestimmte Gene notwendig. Wenn man die nicht hat, riecht der Urin nach einem Spargelessen nicht anders als sonst. Das Sonnen-Niesen scheint ebenfalls so eine Eigenschaft zu sein, die man, genetisch bedingt, entweder hat oder nicht. Was passiert in der Nase, wenn man dieses Gen hat und in die Sonne guckt? Ganz genau ist das nicht geklärt, aber die vorherrschende Lehrmeinung ist, dass bei diesen Menschen zwei Nerven sehr nah beinander verlaufen, nämlich der Sehnerv und der Trigeminus – "Drillingsnerv". Dieser Drillingsnerv hat mehrere Äste, darunter einen, der zum Augapfel führt und einen anderen, der zum Oberkiefer führt und beim Niesen eine wichtige Rolle spielt. Eine Hypothese sagt, dass es bei Sonnenniesern zu einer Art Kurzschluss kommt: Wenn die Augen-Nerven stark gereizt werden, springen diese Signale auf den Oberkieferast des Trigeminus über und dadurch wird der Niesreflex ausgelöst. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sonnennieser per se lichtempfindlicher sind – auch dafür gibt es Hinweise. Auf jeden Fall tritt der Reflex fast immer nur dann auf, wenn die Betroffenen unvermittelt starkem Licht ausgesetzt sind – sobald das Auge reagiert und z.B. die Pupille sich verengt, hört das Niesen wieder auf. Kann die Kettenreaktion zwischen Auge und Nase auch gefährlich werden? An sich nicht. Ein evolutionärer Sinn ist zwar nicht zu erkennen, aber offenbar gehen auch keine Gesundheitsgefahren davon aus. Es ist eher eine harmlose genetische Anomalie. Gefährlich wird es allenfalls z.B. für Kampfpiloten; für die könnte ein solcher Reflex zumindest problematisch sein. Normale Piloten dagegen schauen selten spontan in die Sonne und fliegen normalerweise auch keine Manöver, bei denen ein kurzes Niesen gefährlich sein könnte.Thu, 9 Nov 2023 - 02min - 5548 - Was passiert beim Niesen im Körper?
Niesen ist ein Reflex
Das Niesen ist physiologisch ein explosives Atmen – es sind also die gleichen Körperpartien beteiligt wie beim normalen Atmen auch: das Zwerchfell, die Atemmuskeln in Bauch und Brust. Mit zwei wesentlichen Unterschieden: Das Atmen können wir zumindest teilweise kontrollieren und die Luft zumindest vorübergehend anhalten – beim Niesen geht das kaum; es ist ein Reflex. Zweiter Unterschied: Die normale Atmung ist ruhig, das Niesen geschieht explosionsartig. Physiologisch passiert Folgendes: Es beginnt damit, dass die Nervenzellen in der Nasenschleimhaut irgendeinen Reiz empfangen. Das können Allergene sein, Pollen, Katzenhaare, die Exkremente von Hausstaubmilben. Die Schleimhaut kann durch eine Erkältung gereizt sein oder auch einfach durch Sonnenlicht – manche Menschen müssen ja niesen, wenn sie in die Sonne gucken."Nieszentrum" im Gehirn gibt die Kommandos
Die Nerven leiten diese Reizinformation ins Gehirn weiter. Im Übergang vom Hirnstamm zum Rückenmark gibt es ein Areal, von dem man ausgeht, dass das die Niessteuerung übernimmt – deshalb bezeichnet man es auch als "Nieszentrum". Das gibt dann seine Kommandos. Erstes Kommando: Einatmen! Meist denken wir beim Niesen nur an das große "Hatschi!" – aber dem geht immer ein kräftiges Einatmen voraus. Dabei wird zugleich ein Druck aufgebaut. Als nächstes folgt ein Kommando an die Ausatemmuskeln. Die ziehen sich dann schlagartig zusammen und katapultieren die eingeatmete Luft nach draußen – und zwar mit orkanartigen Geschwindigkeiten von 160 km/h. Gleichzeitig bekommen meist auch die Augen noch das Kommando: Schließen! Warum wir die Augen beim Niesen schließen, ist nicht ganz klar, vermutlich wird auf diese Weise verhindert, dass Krankheitserreger in die Augen gelangen.Niesen dient dem Reinigen der Nase
Der Niesreflex insgesamt dient somit vor allem der Reinigung der Nase: Wir befreien sie damit von Partikeln und Erregern, die wir mit dem normalen Atmen nicht loswerden.Wed, 1 Nov 2023 - 02min - 5546 - Wie kriegen Waschmittel den Dreck aus der Wäsche?
Die wichtigsten Bestandteile in Waschmitteln sind Tenside. Das sind die Stoffe, die den Schmutz lösen und die Wäsche sauber machen.
Mit Tensiden gegen Grenzflächenspannung des Wassers
Tenside tun das, indem sie die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen. Wasser hat an der Oberfläche tatsächlich eine Spannung. Die zeigt sich zum Beispiel darin, dass manche Insekten übers Wasser laufen können. Diese Grenzflächenspannung führt aber auch dazu, dass Wasser in die Feinstrukturen von Gewebe nicht immer richtig eindringt. Wenn Tenside sich im Wasser lösen, setzen sie diese Grenzflächenspannung herab. Dadurch dringt das Wasser leichter in das Gewebe ein und die Fasern werden besser mit der Waschlösung benetzt.Tenside sind im Wasser löslich und können Fett binden
Diese Fähigkeit verdanken Tenside ihrem chemischen Aufbau. Ihre Moleküle sind ähnlich aufgebaut wie die von Seifen. Sie bestehen aus einem polaren und einem unpolaren Ende. Polar heißt, dass ein Ende des Moleküls elektrisch positiv oder negativ geladen ist. Ein unpolares Ende dagegen ist elektrisch neutral. Und das Tensidmolekül besitzt eben beides, elektrisch geladene und neutrale Enden. Genau deshalb können sie die Flecken aus unseren Klamotten rauslösen. Der polare Teil des Tensids sorgt nämlich dafür, dass das Tensid im Wasser löslich ist. Er ist wasserliebend. Denn Wassermoleküle sind ebenfalls polar. Wasser kann aber kein Fett lösen, denn Fettmoleküle sind unpolar. Mit Wasser können wir deshalb kein Fett aus Textilien herauswaschen. Mit Tensiden geht das aber, denn Tenside haben ja auch einen unpolaren Teil. Der wiederum kann Fett binden.Schmutz in Mizellen: Abtransport per Wasser
Mehrere Tensidmoleküle zusammen können so den Schmutzpartikel wie eine Kapsel umschließen und "einpacken". Dabei entsteht eine sogenannte Mizelle – eben ein Schmutzteilchen, das von Tensiden umhüllt ist. Sie kann vom Wasser leicht abtransportiert werden.Bleichmittel erforderlich, wo Tenside an ihre Grenzen stoßen
Aber nicht alle Flecken können von Tensiden entfernt werden. Bei Obst-, Gemüse- oder Kaffeeflecken wird es schon schwieriger. Manchen Waschmitteln werden deswegen Bleichmittel zugefügt. Die zerfallen in wässriger Lösung und setzen atomaren Sauerstoff frei. Der zerstört die Farbstoffe aufgrund seiner stark oxidierenden Wirkung. Empfindliche Fasern können allerdings auch angegriffen werden. Fein- und Buntwaschmittel enthalten deshalb in der Regel keine Bleichmittel.Enzyme gegen Eiweiß, Fett und Stärke
Und es gibt noch einen dritten Player im Waschmittel-Game: die Enzyme. Die entfernen Schmutzstoffe wie Eiweiß, Fett und Stärke, indem sie diese spalten und abbauen. Die Wäschepflege wurde durch die Enzyme sehr viel umweltschonender, weil sie eine niedrigere Waschtemperatur brauchen. Temperaturen über 60 °C zerstören die Enzyme nämlich. Dank Waschenzymen wird also viel Energie gespart.Sun, 29 Oct 2023 - 03min - 5545 - Entstanden unsere Redensarten vor allem im Mittelalter?
In der Romantik herrscht besonderes Interesse am Mittelalter
Seit der Romantik hatte man beim Publikum sehr viel Erfolg mit dem Mittelalter: Mittelalterromane und Mittelalterdramen entstanden. Und mit dem Film auch die Mittelalterfilme. Die hatten einen unerhörten Erfolg. Auch bei den Erklärungen für Redensarten und Sprichwörter beginnt man sehr gerne mit der schönen Einleitung "Schon im Mittelalter ..."Mittelalter umfasst rund 1.000 Jahre
Da stellt sich jedoch die Frage: Welches Mittelalter denn? Wenn wir die grobe Einteilung 500 bis 1500 nehmen, sind das 1.000 Jahre. Und es ist ein Unterschied, ob etwas um 800, um 1100 oder um 1400 im Schwange ist. Da bin ich schon vorsichtig. Mit der Romantik, mit dieser starken literarischen Betonung des Mittelalters, wurden Wendungen, die im Mittelalter vorkamen, aber gar nicht so häufig waren, plötzlich wichtig und modern. Es gab auch viele bildliche Darstellungen; dadurch sind die überhaupt wieder in Schwange gekommen, nachdem sie eigentlich gar nicht mehr so beliebt gewesen waren. "Nägel mit Köpfen machen" geht zum Beispiel definitiv auf das Handwerk des Nagelschmied zurück, der einen schweren Baunagel zu schmieden hatte. Das erforderte harte und gute Arbeit. Das wurde erst um 1800 zu einer Redensart, obwohl die Grundlage dafür wesentlich älter war.Beispiel "Holzauge, sei wachsam!"
Bei "Holzauge, sei wachsam" kann man klar sagen, dass es hierzu falsche Behauptungen gibt. Dass der Ausdruck nämlich von einer drehbaren Kugel in einer Schießscharte herkomme. Oder von einer Art Guckloch in Toren von Burgen. Denn diese Redensart kommt aus dem Kartenspiel; da ist sie besonders beliebt. Sie ist vor dem Zweiten Weltkrieg praktisch überhaupt nicht zu finden – vielleicht ein paar Jahre davor, aber keineswegs im Mittelalter oder auch nur im 16. der im 17. Jahrhundert. Es ist definitiv später erfunden worden. Wer Karten spielt, weiß, dass das damit einhergeht: eine ganz bestimmte Geste nämlich. Man zieht das untere Augenlid nach unten. Es ist nicht hundertprozentig möglich zu erklären, woher es wirklich kommt. Aber wenn man sich die Lexika ansieht, findet man "Holzauge" als Bezeichnung für das "Astloch" und durch das Astloch schauen. Das kommt zum Beispiel bei Friedrich Schiller in "Kabale und Liebe" vor."Und wenn du aus jedem Astloch ein Auge strecktest und vor jedem Blutstropfen Schildwache ständest ..."
Es kommt aber auch später, gerade im soldatischen Zusammenhang, bei vielen Witzen vor, wo Männer durch Bretterzäune schauen, hinter denen leicht oder gar nicht bekleidete Frauen zu sehen sind. Im Fliegerjargon war das Holzauge ein Jagdflieger, der auf seinen Rottenführer ein besonderes Auge hatte, oder auch die Kokarde an feindlichen englischen Bombern. Das alles spielt hier zusammen. Es ist wohl so, dass man mit eine Art bösem Witz darauf anspielt, dass selbst eine Holzprothesen von einem Auge, das wäre ja eigentlich ein Glasauge, selbst dieses Auge müsste wachsam sein. Gerade im Zusammenhang mit dem soldatischen Herkunftsgebiet und mit dem Jagdfliegen kann man sich vorstellen, dass das sehr leicht in das Kartenspiel und über das Kartenspiel in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Aber mit dem Mittelalter hat es nichts zu tun.Quelle: Miller, 1. Akt, 1. Szene: "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller
Wed, 13 Sep 2023 - 04min - 5543 - Muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk "neutral" sein?
Was bedeutet "neutral"?
Es wird manche überraschen, aber das steht so nirgends. Wir bekommen immer wieder Publikumspost, in der uns eine Hörerin oder ein Zuschauer vorwirft, wir würden unsere Neutralitätspflicht verletzen – wenn etwa ein journalistischer Beitrag über gesellschaftlich strittiges Thema einen bestimmten Tenor hat oder zu einem Ergebnis kommt, das manchen nicht gefällt. Dann heißt es, wir seien nicht "neutral". Liest man sich aber die juristischen Grundlagen für die Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch, dann taucht das Wort "neutral" gar nicht auf. Aus guten Gründen, weil das Wort "neutral" auch ein wenig nebulös ist. Die "Neutralität" der Schweiz meint etwas anderes als die "Neutralität" des Schiedsrichters. "Neutral" kommt ja aus dem Lateinischen "Ne utrum", auf deutsch: "keins von beidem". Aber was bedeutet das konkret: Versteht man unter Neutralität, dass man keine Position bezieht? Oder noch schärfer, dass man sich aus Auseinandersetzungen komplett heraushält? Oder bedeutet es nur, dass man keine Partei ergreift? Darüber kann man lang philosophieren, muss man aber in dem Fall gar nicht, weil die Rechtsgrundlagen, die den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks definieren, genauere Begriffe verwenden als "Neutralität" . Kurz, welche sind das? Das ist zum einen der Medienstaatsvertrag, der zwischen allen Bundesländern geschlossen wurde. Daneben gibt es Staatsverträge bzw. Gesetze für die einzelnen Rundfunkanstalten. Zum Beispiel gibt es für den Südwestrundfunk, den SWR, einen Staatsvertrag zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.Wie muss der ÖRR berichten?
Da steht nichts von Neutralität, aber dort stehen andere Begriffe, die präziser sind. Beispielsweise steht im Medienstaatsvertrag, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Gewährleistung einer "unabhängigen, sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden Information und Berichterstattung" verpflichtet sind. Sie sollen die "Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit" achten. Und "in ihren Angeboten eine möglichst breite Themen- und Meinungsvielfalt ausgewogen darstellen."Staatsvertrag des SWR führt die Pflichten weiter aus
Ähnliche Begriffe finden sich im Staatsvertrag des SWR. Dort heißt es, Berichterstattung und Informationssendungen sind "gewissenhaft zu recherchieren und müssen wahrheitsgetreu und sachlich sein." Und es heißt: "Die Redakteurinnen und Redakteure sind bei der Auswahl und Sendung der Nachrichten zur Objektivität und Überparteilichkeit verpflichtet."Pflicht zur Unabhängigkeit und Überparteilichkeit der Berichterstattung
Und diese Begriffe sagen ja eigentlich viel klarer, worum es geht. Wenn wir es aufdröseln, fordert der Auftrag somit also zunächst Unabhängigkeit und Überparteilichkeit. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll nicht abhängig sein vom Staat, von einer Regierung, von Parteien oder anderer Interessengruppen. Niemand soll durch großzügige Spenden oder umgekehrt politischer Einflussnahme die Berichterstattung beeinflussen dürfen. Einfacher gesagt: Der Auftrag fordert nicht Neutralität, sondern zunächst vor allem Unabhängigkeit der Berichterstattung. Das bedeutet aber nicht, dass die, die dort arbeiten, einfach machen können, was sie wollen und ihre eigenen Interessen propagieren, denn – und das war ja das andere Begriffscluster – die Berichte sollen wahrheitsgetreu, sachlich und objektiv sein. Wenn man also schon mit "neutral" kommt, entspricht die gebotene Neutralität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eher der der Schiedsrichters - unabhängig, unparteiisch, aber gleichzeitig beauftragt, zu "sagen, wie es wirklich ist". Schiedsrichter werden oft auch als die "Unparteiischen" bezeichnet - so gut wie nie aber als "die Neutralen". Aus guten Gründen - den gleichen Gründen, weshalb der Begriff auch im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk missverständlich sein könnte.Warum Schiedsrichter nur bedingt "neutral" sind
Neutralität könnte ja so verstanden werden, dass die Berichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keine Position beziehen und zu keinem Ergebnis kommen dürften, das etwa einer Partei besser gefällt als einer anderen. Das dürfen sie aber sehr wohl, vorausgesetzt, die Berichte sind wahrheitsgetreu und objektiv. Wenn der ehemalige US-Präsident Donald Trump behauptet, er habe die Wahl 2020 gewonnen, dann darf ich als öffentlich-rechtlicher Journalist sagen, dass er dafür noch keine Belege vorgelegt hat. Ich berichte dann zwar nicht "neutral" in dem Sinn, denn ich nehme ja sehr wohl eine inhaltliche Bewertung von Trumps Behauptung vor. Das tue ich aber unabhängig und wahrheitsgetreu. Und das ist auch in Ordnung.Wann ist Berichterstattung "ausgewogen"?
Oder: Wenn Politikerin X behauptet, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel und Politiker Y behauptet das Gegenteil, wenn sich die überwältigende Mehrheit in der Wissenschaft einig ist, dann ist der Auftrag, dass wir uns an der Wissenschaft orientieren und nicht aus falsch verstandener "Neutralität" beide Positionen als gleichberechtigt darstellen. Denn das wäre false balance –eben: falsche Ausgewogenheit. Da bin ich beim nächsten Schlüsselbegriff. Ausgewogenheit steht tatsächlich auch im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wenn da sonst nichts weiter stehen würde, könnte man "Ausgewogenheit" so verstehen, als müssten alle Beiträge immer alle erdenklichen Meinungen wiedergeben. Dass das aber nicht gemeint ist, wird deutlich, wenn man sich die Passagen genauer anschaut. Im Medienstaatsvertrag heißt es, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sollen in ihren Angeboten eine möglichst breite Themen- und Meinungsvielfalt ausgewogen darstellen. Hier bezieht sich die Ausgewogenheit erstmal auf die Themenauswahl. Es gibt viele Themen, die interessant und wichtig sind, die soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgewogen abbilden. Und es gibt zu diesen Themen jeweils verschiedene Meinungen, die ebenfalls ausgewogen abgebildet werden müssen. Was heißt das nun wieder?Ausgewogenheit im Gesamtangebot, nicht in jedem einzelnen Beitrag
Im Staatsvertrag für den Südwestrundfunk heißt es: "In allen Angelegenheiten von öffentlichem Interesse sind die verschiedenen Auffassungen im Gesamtangebot ausgewogen und angemessen zu berücksichtigen." Wichtig ist dabei das Wort Gesamtangebot: Das heißt, nicht jeder einzelne Beitrag muss alle Auffassungen zu Wort kommen lassen, sondern die Forderung richtet sich an die Summe der Beiträge. Deshalb darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch sehr pointierte Kommentare senden, also ausgewiesene Meinungsbeiträge, die für sich genommen vielleicht als einseitig erscheinen können – entscheidend ist aber eben das Gesamtangebot. Und es steht ja nicht nur "ausgewogen" da, sondern auch "angemessen". Mit anderen Worten: Nicht jede Auffassung muss im gleichen Maße abgebildet werden. Die Einzelmeinung eines politischen Hinterbänklers verdient deshalb nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie die einer Ministerin oder eines Fraktionschefs der Opposition, die ja als Teil einer Regierung sprechen oder eben die Haltung ihrer Partei wiedergeben. Und genauso ist es "angemessen", dass Positionen, die sich auf Fakten und auf Wissenschaft stützen, im Programm berücksichtigt werden und eine unbelegte Verschwörungserzählung gar nicht. Das mag, je nach Sichtweise, nicht "neutral" sein, aber es ist wahrheitsgetreu, sachlich, objektiv, und es ist trotzdem ausgewogen und angemessen.Mon, 23 Oct 2023 - 06min - 5542 - Was ist die Menopause?
Letzte Regelblutung
Die Menopause ist die letzte Regelblutung, der ein Jahr lang keine weitere spontane Regelblutung folgt. Das kann man nur retrospektiv festlegen, denn man weiß ja in dem Moment nicht, ob es die letzte Blutung war oder nicht. Ein Jahr nach dieser letzten Regelblutung spricht man von der Postmenopause. Das ist dann die Phase, wo man richtig im Östrogenmangel angekommen ist und die Eierstöcke gar keinen Östrogen mehr bilden oder wirklich nur so wenig, dass es nicht mehr relevant ist.Perimenopause schon ab 40 möglich
Die Phase vor dieser letzten Regelblutung ist relativ lang. Die haben viele gar nicht so sehr im Blick, weil alle immer nur denken Postmenopause, Menopause gleich Hitzewallungen. Die Phase davor die Perimenopause. Die kann tatsächlich schon mit 40, 45 anfangen. Sie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass die hormonelle Aktivität sehr stark schwankt. Der Eierstock arbeitet nicht mehr richtig stabil. Das macht ganz andere Symptome als die Phase danach, die Postmenopause.Sun, 22 Oct 2023 - 01min - 5541 - Wie entstand der Gazastreifen als politisches Gebilde?
Gaza: schmaler Küstenstreifen zwischen Israel und Ägypten
Schon beim Blick auf die Landkarte wirkt der Gazastreifen merkwürdig. Ein kleiner schmaler Küstenstreifen, eingekapselt zwischen Israel und Ägypten. Der Gazastreifen ist 40 km lang – das ist weniger als die Strecke von Heidelberg bis Karlsruhe. Im Norden ist er nur 6 km breit, im Süden 14 km. Doch in diesem schmalen Streifen leben 2 Millionen Menschen – er ist somit dichter bevölkert als eine deutsche Großstadt.Balfour-Erklärung 1917: "Heimstätte" für das jüdische Volk soll in Palästina errichtet werden
Die Geschichte im Schnelldurchlauf: Bis zum Ersten Weltkrieg gehörte Palästina zum Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich gehörte aber zu den Kriegs-Verlierern und hat sich aufgelöst. Palästina wurde Mandatsgebiet von Großbritannien. In dieser Zeit, aber auch schon vorher, wanderten viele Juden nach Palästina aus. Großbritannien hatte schließlich den Juden schon 1917 versprochen, in Palästina eine Heimstätte für das jüdische Volk zu schaffen. Das war die berühmte Balfour-Erklärung. Das führte allerdings zu schweren Konflikten mit den dort ebenfalls lebenden Arabern und führte auch zu Aufständen. Speziell aus Gaza zum Beispiel wurden 1929 alle Juden vertrieben. Großbritannien war mit den wachsenden Spannungen überfordert und stand unter Druck, das Mandat für Palästina an die Bevölkerung zurückzugeben, also Palästina in die Unabhängigkeit zu entlassen. Aber die Bevölkerung bestand zu diesem Zeitpunkt aus Arabern und Juden, und die hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen. Also übergab Großbritannien das Problem an die Vereinten Nationen; diese verabschiedeten einen Teilungsplan.Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat
Palästina wurde also auf dem Papier in einen jüdischen und einen arabischen Staat geteilt. In diesem Teilungsplan zerfiel übrigens auch der jüdische Staat in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Jerusalem gehörte in diesem Plan nicht zum jüdischen Staatsgebiet, sondern sollte unter internationale Kontrolle gestellt werden. Bei diesem Teilungsplan wurde auch berücksichtigt, wo die Juden damals hauptsächlich lebten. In Gaza lebten sie nicht, denn von dort waren sie ja 1929 bei arabischen Aufständen vertrieben worden. Deshalb wurde das Gebiet des heutigen Gazastreifens dem palästinensischen Staat zugeschlagen – aber der Gazastreifen war in diesem Teilungsplan noch nicht isoliert, sondern Teil eines etwas größeren zusammenhängenden Gebietes, das zu einem künftigen arabischen Staat gehören sollte.Israel wird 1948 unabhängig
1948 erklärte Israel seine Unabhängigkeit. Kurz darauf wurde es von seinen Nachbarn angegriffen und konnte sich behaupten. Das war der israelische Unabhängigkeitskrieg oder auch Palästinakrieg. In der Folge dieses ersten Krieges wurde die Landkarte nochmal neu gezeichnet – und der Gazastreifen ist ein Ergebnis davon. Denn Israel vereinbarte einen Waffenstillstand mit Ägypten. Israel konnte sein Gebiet zwar ausdehnen, aber Ägypten bekam die Kontrolle über den Gazastreifen. Das bedeutet nicht, dass die Menschen im Gazastreifen dort zu Ägyptern wurden. Sie wurden zwar von Ägypten verwaltet, hatten aber keine staatsbürgerlichen Rechte. Ebenfalls infolge des Palästinakriegs flohen Hunderttausende Palästinenser aus dem Staatsgebiet Israels oder wurden vertrieben ("Nakba"). Etwa ein Drittel von ihnen ging in dieses kleine, von Ägypten verwaltete Gebiet, das seitdem auch als "Gazastreifen" bezeichnet wird.Palästinensische Autonomiegebiete nach Osloer Friedensabkommen
Aber er blieb nicht bei Ägypten: Im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt Israel den Sinai, den Gazastreifen und das Westjordanland. 1979 schließen Ägypten und Israel Frieden, der Sinai geht an Ägypten zurück, der Gazastreifen bleibt unter israelischer Besatzung, die dort auch jüdische Siedlungen zulässt. Mitte der 1990er schließen Israel und die Palästinenser einen formalen Frieden im Osloer Friedensabkommen. Dabei entsteht das, was heute als "palästinensische Autonomiegebiete" bekannt ist. Der größte Teil des Gazastreifens und Teile des Westjordanlands kommen unter die Verwaltung der palästinensischen Autonomiebehörde. Der Gazastreifen ist zwar das kleinere der beiden Gebiete, besteht aber aus einer zusammenhängenden Fläche – im Gegensatz zum administrativ zersplitterten Westjordanland. Im Westjordanland bleiben die israelischen Sicherheitskräfte und Verwaltung präsent. Dort entstehen immer neue illegale israelische Siedlungen. Aus dem Gazastreifen dagegen zieht sich Israel bis 2005 zurück und räumt dort auchdie jüdischen Siedlungen. Auch politisch entwickeln sich beide Gebiete auseinander. Im Westjordanland dominiert die gemäßigte Fatah, im Gazastreifen wächst die Macht der radikalislamischen Hamas. 2006 fanden in den palästinensischen Gebieten Wahlen statt. Die Hamas gewann diese Wahlen. Weil sie aber Israel nicht anerkennt und bekämpft, wird sie international isoliert. Kurzfristig gibt es eine gemeinsame Regierung mit der gemäßigten Fatah, die im Westjordanland stark ist. Aber die scheitert, die Hamas wirft die Fatah aus dem Gazastreifen raus, herrscht seitdem faktisch alleine, beschießt Israel mit Raketen und erntet Gegenschläge. Das alles hat dazu geführt, dass der Gazastreifen weitgehend abgeschnitten ist, sowohl nach Israel als auch nach Ägypten. Entsprecht kritisch ist die Versorgungslage. Die Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfslieferungen angewiesen. Wenn man also fragt, wann das alles begonnen hat, ist die Antworten: Mit den Ereignissen nach der Staatsgründung und dem Palästinakrieg. Seitdem ist der Gazastreifen das, was er bei allem politischen Hin und Her heute noch ist: Ein kleiner, schmaler, eingekastelter Flecken Erde mit misstrauischen Nachbarn, von denen er aber gleichzeitig extrem abhängig ist.Fri, 20 Oct 2023 - 05min - 5540 - Woher kommt der Ausdruck "unter die Haube kommen"?
Giordano Bruno sagte einmal: "Se non è vero, è ben trovato." Also: "Ist es auch nicht wahr, so ist es doch gut erfunden." – Und diese Geschichte mit der Jagd scheint doch auch ein bisschen weit hergeholt. Viele Gästeführer reagieren enttäuscht und fürchten, ihre Geschichten nicht mehr weitererzählen zu können. Aber das sollen sie meiner Meinung nach ruhig tun. Sie sollten allerdings dazu den Status der Wahrhaftigkeit oder Wahrscheinlichkeit angeben.
Nur verheiratete Frauen durften Hauben tragen
Es ist im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit völlig üblich, dass unverheiratete bürgerliche Frauen keine Brautkronen oder Brauthauben tragen durften – etwa in Franken, wo ich zu Hause bin. Die Haube war die Zier einer verheirateten Frau und nur durch den Akt der Verheiratung war die Frau berechtigt, die Haube zu tragen.Wed, 18 Oct 2023 - 02min - 5539 - Warum verlieren wir im Herbst mehr Haare als sonst?
Man muss sich das so vorstellen: Kein Haar wächst ewig. Bei den meisten Menschen wächst ein Haar 2 bis 6 Jahre lang. Diese Zeit des Wachstums heißt auch "Anagen". Danach gehen die Haarfollikel – also die Stellen in der Haut, aus der die Haare herauswachsen – in eine Ruhephase über – das "Telogen". Sie hören dann auf, Haare zu produzieren, das Haar dünnt dann an der Haarwurzel aus, verliert an Halt – und fällt irgendwann aus. Spätestens dann, wenn das Haarfollikel in die nächste aktive Phase übergeht, ein neues Haar produziert, verdrängt das neue Haar das alte. Dieser Erneuerungsprozess passiert grundsätzlich immer und ständig – ungefähr ein Siebtel unserer Haarpracht, sofern vorhanden, befindet sich im Schnitt jeweils in dieser Erneuerungsphase, in der das Wachstum aufhört, Haare ausfallen und neue nachkommen.
Warum verstärkt sich der Haarausfall im Herbst?
Im Spätsommer und Herbst gehen überdurchschnittlich viele Haarfollikel in diese Ruhephase über. Und zwar deshalb, weil das Haar und die Haarwurzel im Sommer überdurchschnittlich stark belastet wird, vor allem durch viel Sonne und UV-Strahlung, zum anderen durchs Baden in gechlortem Wasser oder in Salzwasser. Vor diesen Belastungen schützen sich die Haarfollikel, indem sie im Sommer in die Ruhephase gehen, und nach ein paar Wochen – also im Herbst fallen dann vermehrt Haare aus. Möglicherweise gibt es auch andere Gründe – eine hormonelle Umstellung im Herbst, aber diese Zusammenhänge sind weniger klar. Individuell ist das aber sehr unterschiedlich. Die einen merken von diesem saisonalen Haarausfall gar nichts, bei anderen bleiben dagegen im September auffallend mehr Haare in der Bürste oder im Abfluss der Dusche zurück. Das Phänomen gibt es übrigens auch nochmal weniger ausgeprägt im Frühjahr. Das könnte damit zusammenhängen, dass der Körper, wenn die Tage länger werden, weniger vom Hormon Melatonin produziert, das beim Haarwuchs eine Rolle spielt. Aber diese Zusammenhänge sind noch nicht so gut erforscht.Gibt es Möglichkeiten, den saisonalen Haarausfall zu stoppen?
Wenn man den saisonalen Haarausfall verhindern will, geht das eigentlich nur, indem man das Haar weniger stresst, also weniger der Sonne aussetzt – sprich: Mütze tragen. Und wenn man weniger im Meer oder im Schwimmbad baden geht. Aber wozu? Man muss sich klarmachen: Bei diesem saisonalen Haarausfall handelt es sich NUR um einen Erneuerungsprozess. Anstelle der ausgefallenen Haare kommen ja in der Regel wieder neue nach. Der Versuch, den herbstlichen Haarausfall zu verhindern, bringt also nicht viel; man verschiebt dadurch den Haarausfall bestenfalls ein paar Wochen oder Monate nach hinten. An der Haarpracht selbst ändert das langfristig aber nichts.Wed, 18 Oct 2023 - 03min - 5538 - Warum packt man seine "Siebensachen"? Warum nicht fünf oder acht?
Es handelt sich wie bei den sieben Schwaben und den sieben Geißlein und den sieben Zwergen um eine Zahl, die unglaublich wichtig ist, die auch schon in assyrischer Zeit eine große Bedeutung hatte: Selbst die Assyrer kannten schon die sieben Meere.
Die Sieben umfasst alles
Dabei geht es auch darum, dass man mit der Sieben eine Art von umfassendem Begriff hatte. Mit der Sieben konnte man sagen: Das ist alles, um das es geht. Die sieben Meere sind eben alle Meere, die es geben soll. Wir wissen, dass es mehr gibt. Aber man ging davon aus: Das umfasst alles. Bei den sieben Sachen hat man die Sieben genauso verwendet. Damit müssen die sieben Sachen also nicht genau sieben sein, sondern es heißt einfach: Alle Sachen, die man mitnimmt.Spöttischer Beiklang im Volksmund
Man hat das aber im Volksmund etwas wörtlicher genommen und gesagt: Na, wenn jemand nur sieben Sachen hat, dann ist das auch klein und ärmlich. Daher kommt dieser spöttische Beiklang, wenn man sagt: "Nun pack deine sieben Sachen und weg mit dir!"Thu, 11 Jan 2024 - 01min - 5537 - Hunde, die bellen, beißen nicht. – Stimmt das?
Bellen: Warnung und Erregung
Wenn Hunde bellen, ist das eine Warnung und auch einfach ein Zeichen für Erregung. Die Frage ist, warum der Hund genau bellt.Auf Ohren, Schwanz und Körper des Hundes achten
Als Mensch behält man die Gefahr ja gern im Blick, aber für den Hund ist das eine Provokation oder Bedrohung. Wenn man in die Situation gerät und Angst hat, sollte man dem Hund also möglichst nicht in die Augen schauen, sondern lieber auf die Ohren, auf den Schwanz oder auf den Körper des Hundes. Wichtig ist, den Hund nicht noch zusätzlich zu bedrohen, sondern man sollte mit Abstand an ihm vorbeigehen.Sun, 22 May 2022 - 00min - 5536 - Warum vergeht die Zeit im Alter schneller?
Schon viel erlebt
Zum einen setzen wir die Zeit, die wir erleben, ins Verhältnis zu der Zeit, die wir schon erlebt haben. Für einen Zehnjährigen ist ein Jahr ein Zehntel seiner gesamten Lebenszeit, für eine Fünfzigjährige ist das selbe Jahr nur ein Fünfzigstel – sie hat schon 49 andere erlebt. Das ist ein Grund, warum uns das fünfzigste Lebensjahr kürzer vorkommt als das zehnte. Hinzu kommt: Die Zeit erscheint uns im Rückblick umso länger, je mehr passiert ist. Das bestätigt der Psychologe Marc Wittmann, der sich in Freiburg intensiv mit dem Phänomen Zeiterleben beschäftigt.In ersten 30 Jahren passiert mehr Neues
Und das gilt auch fürs ganze Leben: In den ersten dreißig Lebensjahren passiert viel: Wir werden groß, Schule, Ausbildung, oft eine Reihe von Partnerschaften. In den zweiten dreißig Jahren kann sich auch noch einiges tun, aber in der Regel weniger. Wir bleiben so groß wie wir sind, die Persönlichkeit ist schon ausgebildet, unser Alltag ändert sich über lange Zeit oft nur wenig.Im Alter passiert weniger "zum ersten Mal"
Deshalb kommt es Menschen im Rückblick die ersten 30 Jahre länger vor. Denn da passiert so viel, auch emotional. Vieles passiert zum ersten Mal, erste Liebe, erster Sex, erste eigene Wohnung, erster Urlaub ohne Eltern, der erste Job, alles aufregend. Je älter wir werden, desto mehr haben wir schon von der Welt gesehen, desto weniger passiert „zum ersten Mal“. Es gibt weniger einschneidende Ereignisse. Auch das erklärt, warum die Zeit im Alter scheinbar schneller vergeht.Kürzere Zeitspannen werden ähnlich lang erlebt
Zumindest gilt das, wenn wir auf längere Zeitspannen zurückblicken, auf die letzten fünf oder zehn Jahre. Bei kürzeren Zeitspannen trifft das nicht unbedingt zu. Eine Woche oder einen Tag empfinden eine 20-Jährige nicht unbedingt länger als ein 60-Jähriger. Da kommt es sehr stark darauf an, was in dieser Zeit konkret passiert.Langweilige Zeiten sind in der Erinnerung kurz
Und dabei gibt es noch ein interessantes Phänomen. Psychologen unterscheiden nämlich zwischen der Zeit, die aktuell vergeht, und der Zeit, auf die wir zurückblicken. Ein aufregender zweiwöchiger Urlaub mit vielen eindrucksvollen Erlebnissen vergeht gefühlt recht schnell – in der Erinnerung nehmen diese zwei Wochen aber viel mehr Raum ein, als wenn man die selben zwei Wochen im Büro verbracht hätte. Umgekehrt: zwei Stunden im Wartezimmer einer Arztpraxis können sich endlos hinziehen – im Gedächtnis bleiben sie dagegen allenfalls als kurze Momentaufnahme. Anders ausgedrückt: Langweilige Zeiten sind in der Erinnerung kurz und kurzweilige in der Erinnerung lang – und das gilt für Jung und Alt gleichermaßen.Sat, 14 May 2022 - 02min - 5535 - Verbraucht ein Auto mehr Sprit im Leerlauf oder mit eingelegtem Gang?
Schubabschaltung: Kupplung drin – Fuß vom Gas – kein Spritverbrauch
Typischer Fall: Man rollt auf eine Ampel zu oder fährt einen Berg hinunter. Da empfiehlt es sich in den allermeisten Fällen, den Gang eingelegt zu lassen. Dann wird bei den meisten Autos heute die Kraftstoffzufuhr vollständig unterbunden – sie verbrauchen dann überhaupt keinen Treibstoff mehr. Das Prinzip nennt sich Schubabschaltung: Sobald der Fuß vom Gas geht, wird bei eingelegter Kupplung kein Sprit mehr verbrannt. Das kann übrigens jeder sehen, der eine Verbrauchsanzeige im Auto hat: Die zeigt dann nämlich einen Verbrauch von Null Litern an. Wenn man dagegen die Kupplung tritt oder auskuppelt, wird wieder eingespritzt – und damit wird zumindest eine gewisse Menge Benzin verbraucht. Das sind im Leerlauf eben doch noch 1 bis 2 Liter auf 100 Kilometer.Motorbremse bei eingelegtem Gang
Wenn man einen Berg hinunter fährt, ist die Motorbremse ganz angenehm, weil man dann nicht dauernd bremsen muss. Falls man doch mal bremsen muss, ist es sogar sicherer, wenn die Bremswirkung durch die Motorbremse verstärkt wird. Es gibt allerdings auch Ausnahmefälle: Dann nämlich,wenn das Auto mit der Motorbremse zu langsam wird und die die Drehzahl so gering wird, dass der Motor abzuwürgen droht. Dann wird doch wieder Treibstoff eingespritzt und somit auch verbraucht. Bei nur leichtem Gefälle kann es beispielsweise passieren, dass man das Auto zwar im Leerlauf rollen lassen kann, ohne an Tempo zu verlieren; aber wenn man den Gang einlegt, wird es immer langsamer – und dann muss man wieder Gas geben. So verbraucht man unterm Strich doch wieder mehr Sprit. Das merkt man aber meist intuitiv. Ansonsten gilt: Im Zweifel lieber den Gang drin lassen, solange der Wagen rollt.Thu, 25 Jan 2024 - 02min - 5534 - "Ach du grüne Neune!" – Woher kommt der Ausdruck?
Über die Herkunft sind sich die Sprach- und Sprichwortforscherinnen und -forscher nicht ganz einig. Eine Idee lautet, dass es von einem Berliner Lokal kommen könnte. Tatsächlich ist es wohl auch im 19. Jahrhundert in Berlin aufgekommen. Dieses Lokal hatte eine Adresse, die man über den Grünweg erreichte, und es hatte die Nummer 9. Dort sei es immer sehr hoch hergegangen, sodass man es sich als Ausdruck der Empörung hätte vorstellen können.
Viele Redensarten um die Farbe Grün
Man muss aber wissen, dass es sehr viele Redensarten mit dem Ausdruck "grün" gibt: Auf keinen grünen Zweig kommen, ich bin dir grün, ein grüner Junge sein usw. Es kann auch negativ behaftet sein, etwa in dem Ausdruck "grün und gelb vor Neid sein". Die Neun gehört zu den symbolischen Zahlen. Dahinter könnte demnach auch eine Zahlenmystik stehen. Aber wie gesagt: Hier stochert die Sprichwortforschung im Nebel.Mon, 1 Jan 2024 - 01min - 5533 - Warum klumpt Käsefondue?
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass es bei der Kombination „Wein im Käsefondue“ zur Klumpenbildung kommt und leider keine homogene Masse entsteht. Denn der Käse besteht im Wesentlichen aus Milchproteinen. Das Hauptprotein nennt man Kasein; da steckt das Wort „Käse“ drin. Kasein ist sehr stark wasserhassend. Es besteht aus vielen Aminosäuren, die das Wasser gar nicht mögen. Die mögen viel lieber Fett.
Zu viel Wasser im Fondue sorgt für Klumpen
Wenn man den Käse schmilzt, ist fast kein Wasser mehr drin. Dann kann sich eine homogene Masse bilden, ähnlich einem Teig. Wenn Sie nun aber Wein zum Käse geben, ist wieder zu viel Wasser enthalten. Dann klumpen die hydrophoben Aminosäuren, die also das Wasser nicht mögen, zusammen.Etwas Schnaps kann helfen
Ein bisschen Schnaps kann dann helfen. Man kann etwas Kirschwasser in das Fondue geben, denn der Schnaps hat mehr Alkohol als der Wein – und Alkohol wirkt fettlösend.Fri, 31 Dec 2021 - 01min - 5531 - Warum haben Frauen so oft kalte Füße?
Männer haben Socken im Bett nicht nötig
Mit solch pauschalen Behauptungen muss man in Zeiten von Sexismus-Debatten vorsichtig sein. "So oft" ist vielleicht übertrieben, aber es scheint Frauen zumindest statistisch öfter zu treffen als Männer. Und auch öfter, als es der Jahreszeit bzw. der tatsächlichen Temperatur entspricht. Frauen sind es auch eher, die die Socken im Bett anbehalten, Männer machen das seltener, und offenbar nicht nur, weil es uncool ist, sondern auch, weil sie es tatsächlich nicht so nötig haben.Mehr Muskelmasse, mehr Wärme
Der Frauenkörper geht anders mit Wärme um. Männer haben mehr Muskeln – im Verhältnis zum Körpergewicht fast die doppelte Muskelmasse – und Muskeln produzieren nun mal viel Wärme. Diese Wärme verteilt sich im Körper. Außerdem haben Männer noch einen zweiten Vorteil: Sie haben im Schnitt ein größeres Körpervolumen und somit ein besseres Verhältnis von Körperoberfläche zur Masse. Der Körper gibt somit die Wärme weniger schnell ab. Frauen dagegen sind im Nachteil: Sie produzieren weniger Wärme und speichern diese auch noch schlechter. Beides führt dazu, dass ihr Körper öfter auf "Energiesparmodus" schaltet. Das macht er, indem er sich aufs Wesentliche konzentriert – die inneren Organe, die Körpermitte. Die Versorgung der äußeren Extremitäten dagegen – also Hände und Füße – wird heruntergefahren, weil die es nicht so nötig haben. Denn kalte Füße sind zwar unangenehm beim Einschlafen, aber ansonsten nicht weiter gefährlich.Weitere Ursachen sind möglich: Schuhe, Blutdruck, Ernährung und mehr
Kalte Füße können natürlich auch noch andere Ursachen haben – enges Schuhwerk, dünne Sohlen, niedriger Blutdruck, Bewegung, Ernährung bis hin zu psychische Faktoren, Aufregung usw. – das spielt alles mit hinein. Allerdings kenne ich keine Studien dazu, ob es auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, die sich auf den Fußwärmehaushalt auswirken.Mon, 26 Feb 2024 - 02min - 5530 - Warum fliegt ein Buchfink immer wieder gegen meine Fensterscheibe?
Dieser Vogel sieht sein Spiegelbild. In der Fortpflanzungszeit glaubt er, dass er es mit einem Rivalen zu tun hat – und den versucht er zu bekämpfen. Daher wäre es am besten, während der Brutzeit etwas vor diese Stelle zu hängen.
Vögel gehen auch auf Radkappen los
Dieses Verhalten beobachtet man übrigens nicht nur an Fensterscheiben von Gebäuden, sondern auch an geparkten Autos – da gehen die Vögel auf die glänzenden Radkappen los, in denen sie sich ebenfalls spiegeln. Sie kämpfen fast bis zum Umfallen.Wed, 1 Mar 2023 - 02min - 5528 - Der kann mich mal kreuzweise – woher kommt die Redensart?
Obszöne Form der Beleidigung
"Am Arsch lecken" hieß früher "im Arsch lecken" – eine ganz böse Art und Weise, um jemanden zu beleidigen und herabzusetzen. In vielen Redensarten begnügt man sich nicht damit, immer das Gleiche zu sagen, sondern man möchte es noch steigern. Wenn man also jemanden im Arsch lecken kann, dann will man das noch ein bisschen deutlicher machen: Leck mich fett – das ist durchaus modern geblieben. Auch da geht es darum, dass jemand intensiv den Arsch des anderen zu lecken habe. Beim kreuzweise Lecken handelt es sich um eine Steigerung des ursprünglichen Ausdrucks. Hier kommt möglicherweise, aber das ist nur hypothetisch, in der Kreuzform auch noch eine christliche Komponente hinzu, was besonders widerlich ist. Denn wenn ich schon hier im Arsch bin und das dann auch noch in Form eines Kreuzes tue, dann ist das so was von gotteslästerlich – nicht zu singen und zu sagen.Thu, 5 Oct 2023 - 01min - 5527 - Werden bei Vollmond mehr Kinder geboren?
Mehr Geburten bei Vollmond sind nur ein Gerücht
Das hört man oft – es stimmt aber nicht. Das hat mir der Deutsche Hebammen-Verband bestätigt: Es gibt keine Häufungen zu Vollmond.Häufungen an Freitagen – wegen gezielter Geburtseinleitung
Und anders als früher gibt es auch keine Häufungen mehr an Wochenenden; allerdings gibt es Häufungen an Freitagen. Das liegt daran, dass 30 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt kommen oder die Geburten medizinisch gezielt eingeleitet werden. Das passiert überdurchschnittlich häufig an Freitagen: Wenn ein Wochenende ansteht versuchen die Ärzte gerne, das vorher zu erledigen. Denn am Wochenende ist das Personal teurer.Sun, 1 Oct 2023 - 00min - 5526 - Einen Zahn zulegen – woher kommt das?
Falsche Info zum Ursprung der Redewendung hält sich hartnäckig
Man hört es auf Burgen, in Freilandmuseen oder bei Stadtführungen. Es ist fast unausrottbar, denn immer wieder wird behauptet, es gehe hierbei um den Kräuel, eine Art Zahnstangenaufhängung für Töpfe. Wenn man den nach unten hänge, dann werde das Essen schneller gar. Das hört sich gut an. Das Problem: In keiner Sprache der Welt ist sprachlogisch "nach unten" "mehr". "Zulegen" bedeutet aber "mehr".Mehr Dampf auf den Kessel!
Dieser Aufhängemechanismus ist sehr alt. Die Redensart kommt aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts in Schwang, und zwar mit der Industrialisierung und mit den Lokomotiven. Der Volksmund stellte sich vor, dass an einem Zahnrad ein Zahn mehr zu mehr Geschwindigkeit antriebe. Viele Lokomotiven, die damals das Zeichen der Moderne waren, hatten einen Halbzahnkranz am Bodenblech, mit dem man mithilfe eines Hebels den Dampfdruck regulieren konnte. Und wenn man da einen Zahn zulegte, den Hebel also nach vorne schob, dann hatte man mehr Dampf und mehr Geschwindigkeit.Thu, 25 Apr 2024 - 01min - 5525 - Die Kurve kratzen – woher kommt der Ausdruck?
Abkürzung nehmen und andere übertreffen
"Die Kurve kratzen" kann man verbinden mit "den Rang ablaufen" – oder den "Rank", wie man eigentlich hätte sagen müssen. Das hat nämlich nichts mit dem Rang im Theater zu tun. In beiden Fällen geht es vielmehr um eine Abkürzung, die man wählt, indem man die Kurve entweder sehr eng nimmt oder sogar innerhalb der Kurve eine Gerade wählt, um vor einem anderen da zu sein. Das ist beim "Rank ablaufen", beim "Rang ablaufen" der Fall. Dann übertrifft, übertölpelt, betrügt man jemanden. Das hat sich so entwickelt.Wenn der Kutscher mal wieder am Bordstein hängen blieb
Beim "Kurve kratzen" geht es um etwas Ähnliches. Da wird die Kurve "geschnitten", wie man ja auch sagt. Das hat sich sehr gut dadurch gehalten, dass man früher die Bordsteine sehr klar hören konnte, wenn jemand mit einem Wagen bzw. mit einer Kutsche sehr eng daran vorbeifuhr. Dann gab es schreckliche Kratzgeräusche. Prellsteine an Häusern weisen auch noch darauf. Aber das ist sekundär. Die "Kurve kriegen" hängt auch damit zusammen. Das ist eine Weiterentwicklung. In jedem Fall geht es um die schnelle Entfernung von einem Ort, sich schnell vorwärts bewegen oder etwas geschafft haben, indem man es besonders schnell durch diese Abkürzung erreicht hat.Thu, 28 Sep 2023 - 01min - 5523 - Ist Wirtschaftswachstum gleichzusetzen mit Wohlstand?
Wirtschaftswachstum bedeutet: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigt. Wie das gemessen wird, haben wir schon geklärt. Nun misst das Bruttoinlandsprodukt zwar die ökonomische Leistung eines Landes. Aber das heißt nicht, dass ein wachsendes BIP ein Gradmesser dafür ist, wie gut es einer Gesellschaft geht. Denn die Wirtschaftsleistung kann auch durch Katastrophen angekurbelt werden – zum Beispiel, wenn Stürme Häuser zerstören und sie deswegen neu gebaut werden müssen. Auch Kriminalität trägt zu einem wachsenden BIP bei, weil Polizeieinsätze Geld kosten und in die Rechnung einfließen. Und Umweltschützer kritisieren, dass es für das Bruttoinlandsprodukt keinen Unterschied macht, ob durch die Produktion von Waren die Umwelt geschädigt wird. Das BIP ist eine komplexe Rechnung ohne Bewertung von Gut und Böse, wenn man so will. Trotzdem werden die Daten unter anderem von der Politik genutzt, um den Wohlstand einer Nation zu bewerten. Dafür wird das Durchschnittseinkommen pro Kopf genommen, mit dem sich die Situation verschiedener Länder vergleichen lässt. Das BIP sagt allerdings nichts darüber aus, wie gerecht das Einkommen über die Menschen verteilt ist. Zusammengefasst: Es gibt viele Gründe, das Bruttoinlandsprodukt oder die Schlüsse, die manche daraus ziehen, kritisch zu sehen.
Warum ist das BIP dann überhaupt eine so wichtige Größe?
Das liegt daran, dass wir keine bessere Datengrundlage haben als das Bruttoinlandsprodukt. Zufriedenheit, Sicherheit und andere Faktoren, die beim Thema Wohlstand eine Rolle spielen, lassen sich nicht objektiv messen. Die Konjunkturdaten haben zwar auch einen Unsicherheitsfaktor, aber der ist deutlich geringer. Außerdem werden die Daten für das BIP regelmäßig erhoben, alle drei Monate. Die Politik oder auch Unternehmen können die Quartale miteinander vergleichen, bewerten und handeln. Und die nackten Zahlen spielen eben auch eine wichtige Rolle – zum Beispiel, wenn es darum geht, einzuschätzen, wie viele Schulden ein Land aufnehmen und auch wieder zurückzahlen kann.Wenn man die Nachrichten verfolgt, hat man oft den Eindruck, das Bruttoinlandsprodukt müsste immer weiter wachsen – und wenn das mal nicht klappt, ist die Politik direkt in Alarmstimmung. Aber hier in Deutschland geht es uns doch gut – muss die Wirtschaft dann überhaupt noch wachsen? Würde es nicht reichen, wenn sie stagniert?
Rein theoretisch ist eine Volkswirtschaft vorstellbar, in der dauerhaft alles gleichbleibt: Die Menschen in einem Land arbeiten immer gleich viel und stellen gleich viel her. Aber: Zum einen gibt es einen technischen Fortschritt, der es erlaubt, mehr zu produzieren. Auf Wachstum zu verzichten würde also bedeuten, dass wir entweder auf technischen Fortschritt verzichten oder dass die Bevölkerung weniger arbeitet. Jetzt ist Deutschland aber nicht allein auf der Welt und wenn alle anderen Länder auf Wachstum setzen, wir aber nicht, dann würden wir schnell abgehängt werden – zum Beispiel was Forschung und Innovationen angeht. Das würde wiederum Arbeitsplätze und damit auch Wohlstand gefährden. Kommt eine Volkswirtschaft unfreiwillig ins Nullwachstum, dann nennt man das eine statische Wirtschaft. Es gibt aber auch eine Bewegung, die diesen Zustand bewusst herbeiführen will: Das heißt dann Postwachstumsökonomie. Die Befürworter davon räumen aber auch ein: Dafür müssten wir unser Leben ganz schön umkrempeln: Nur noch 20 Stunden arbeiten statt 40 und in der restlichen Zeit selbst Obst und Gemüse anbauen, Gegenstände tauschen und reparieren und auch auf vieles verzichten. Nur, würde das wirklich funktionieren – wenn alle mitmachen? Viele Ökonomen haben daran ihre Zweifel: Wenn die Menschen weniger arbeiten, zahlen sie weniger Steuern – dann hat auch der Staat weniger Geld für Schulen, die Verwaltung und auch für Sozialleistungen und die gesetzliche Rente. Global gesehen kommt dazu: Die Weltbevölkerung wächst und sie kann nur versorgt werden, wenn weltweit mehr Lebensmittel und Waren produziert werden. Deshalb: Auch wenn es in Deutschland Befürworter einer Postwachstumsökonomie gibt – für arme Länder mit starkem Bevölkerungswachstum ist das keine Option.Wed, 13 Sep 2023 - 03min - 5522 - 1000 Antworten – Der Kalender 2024
"1000 Antworten" gibt es jetzt als Kalender für das Jahr 2024. Der Tischkalender bietet jeden Tag eine Frage – und natürlich eine Antwort zum Nachlesen: Warum sind Blumen bunt? Gibt es Blitze aus heiterem Himmel? Was ist Zeit? – Jeden Tag ein kleines Aha-Erlebnis. Der Kalender ist jetzt im Handel erhältlich. Erschienen ist er im Lappan Verlag. ISBN-13: 978-3830321217
Sat, 25 Nov 2023 - 00min - 5521 - Warum hagelt es meistens tagsüber und nicht nachts?
Theoretisch kann es zwar nachts hageln, aber es ist in der Tat eher selten. Hagel entsteht völlig anders als Schnee. Schnee entsteht im Grunde wie Regen: In Wolken kondensiert Wasserdampf. Beim Regen bilden sich dabei Tröpfchen, bei Schnee formen sich viele kleine Eiskristallen, die sich dann zu Flöckchen zusammenklumpen.
Hagel entsteht anders als Regen oder Schnee
Beim Hagel ist es anders. Hagel entsteht, wenn Regentropfen nachträglich gefrieren. Das geschieht vor allem in Gewitterwolken. Gewitterwolken sind bekanntlich sehr mächtig und können sich kilometerhoch auftürmen. Dadurch herrscht in ihnen ein hohes Temperaturgefälle. Das führt dazu, dass kräftige Winde wehen und die Luft in der Wolke durcheinanderwirbeln. Stellen wir uns nun ein kleines Wassertröpfchen vor, das in der unteren Hälfte so einer Gewitterwolke entsteht. Das wird durch einen Luftwirbel erfasst und steigt in der Wolke nach oben. Dort ist es wesentlich kälter – das Tröpfchen gefriert. Und weil es etlichen anderen Tröpfchen auch so geht, entstehen auf diese Weise viele kleine "Hagelembryonen". Die werden in der Wolke immer wieder auf und ab gewirbelt. Sie stoßen mit weiteren Wassertröpfchen oder Eiskristallen zusammen und werden so nach und nach zu größeren Hagelkörnern. Irgendwann sind die Hagelkörner so groß und schwer, dass sie zu Boden fallen.Gewitterwolken mit Hagel bilden sich eher tagsüber
Genau diese Art von Gewitterwolken bilden sich selten nachts. Denn eine Voraussetzung für ihre Entstehung sind hohe Temperaturunterschiede in der Atmosphäre, das heißt ein hohes Temperaturgefälle zwischen oben und unten. Das haben wir zum einen eher in der wärmeren Jahreshälfte, also eher Frühling und Sommer, und es kommt dann am ehesten in den späten Nachmittagsstunden vor. Dann nämlich hat sich die Luft am Boden tagsüber aufgewärmt, während es oben in der Atmosphäre nach wie vor eisig ist. Dieses Temperaturgefälle schafft erst die Voraussetzungen für die starken Aufwinde, die die Tröpfchen in der Wolke nach oben wehen und dort gefrieren lassen. Sobald die Sonne weg ist und es dunkel wird, kühlt sich die Luft am Boden ab. Damit wird das Temperaturgefälle zwischen unten und oben kleiner und so verschwindet die Voraussetzung für die Entstehung solcher Gewitterwolken, in denen Hagelkörner entstehen.Fri, 19 Apr 2024 - 03min - 5520 - Warum sagt man: "Das ist ja eine schöne Bescherung"?
Samson und Delila
Was sagte der Kraftkerl Samson aus dem Alten Testament, nachdem er seine Stärke verloren hatte? "Das ist ja eine schöne Bescherung!" Das Wortspiel mag erlaubt sein, weil es uns an die Ursprünge des Stoßseufzers wie der Weihnachtsgaben führt. Samson verlor seine Kraft, weil ihm Delila die Haare abgeschnitten hatte. Schon im ersten Buch Moses heißt es: "Wenn du mich beschörest, so wiche meine Kraft von mir." Ach, die alten Konjunktive!Zuteilen durch abschneiden: to share – bescheren
Jedenfalls wird deutlich, dass eine Verbindung mit dem Scheren des Haupt- oder Körperhaares gegeben ist. "Bescheren" geht, ob es das Schenken oder das Schneiden bezeichnet, ähnlich wie das englische "to share" zurück auf alte Worte, die eine Zuteilung durch Abschneiden von etwas bezeichnen. Dabei hat "bescheren" als Schenken noch die Zusatzbedeutung, dass diese Zuteilung von höherer oder höchster, also göttlicher Hand herstammt. Das kennen wir aus dem bekanntesten Tischgebet: "Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast." Zu Weihnachten und den Geschenken passte die schöne Bescherung besonders, weil man die Gaben als vom Christkind kommend verstand. Deshalb nannte man Weihnachtsgeschenke ja oft direkt "Christkindle". Ein altes Sprichwort rät übrigens: "Wenn Bescherung ist, tu den Sack auf und vergiss das Zuknüpfen nicht."Im 18. Jahrhundert wird's ironisch
Spätestens seit dem 18. Jahrhundert bürgerte sich die ironische Verwendung des Wortes "Bescherung" ein. Der Ton machte dabei die Musik. Wer seufzte "Da haben wir die Bescherung!" oder "Das ist ja eine schöne Bescherung!" hatte sich in seiner Erwartung auf feine Gaben getäuscht. Schon Johann Wolfgang Goethe schreibt im Götz von Berlichingen: "Da verließen wir uns auf des Kaisers geheime Gunst – nun haben wir die Bescherung." Mir aber bleibt am Ende dieser kleinen adventlichen Redewendungs- und Sprichwortreihe, Ihnen allen im Brustton der Überzeugung zu wünschen: "Schöne Bescherung!"Sun, 17 Dec 2023 - 02min - 5519 - Welche Impfungen sollten Schwangere bekommen?
Influenza-, Pertussis- und Covid-19-Impfung für Schwangere
Impfung ist sehr wichtig, auch in der Schwangerschaft. Von der STIKO (Ständige Impfkommission) gibt es ganz klare Empfehlungen, allen voran Influenza. Gerade in der Grippesaison ist die Influenza-Impfung für Schwangere klar empfohlen.Schutz für die Mutter und Nestschutz fürs Kind
Viele Schwangere, die mit Impfungen sehr zurückhaltend sind, wissen das nicht: Die Impfung dient nicht nur der Schwangeren als Schutz, sondern auch dem Neugeborenen. Noch wichtiger ist es bei Pertussis, also dem Keuchhusten. Diese Impfung ist noch nicht so lange empfohlen, aber ganz klar erwiesen. Man sollte ab der 28. Schwangerschaftswoche impfen. Bei dieser Impfung geht es fast nur um den Nestschutz des Kindes, sodass das Neugeborene nicht schwer krank wird. Ab dem zweiten Trimenon ist außerdem die Covid-19-Impfung für Schwangere empfohlen.Tue, 4 Oct 2022 - 01min - 5518 - Warum befestigt man beim Richtfest ein Bäumchen auf dem Dach?
Wichtiger Rohstoff: Holz
Der Richtbaum wird manchmal auch durch einen Richtkranz ersetzt. Genau lässt sich die Herkunft dieser Tradition nicht mehr feststellen, aber offenbar gab es den Richtbaum schon, bevor es den Weihnachtsbaum gab. Die ersten urkundlichen Erwähnungen des Christbaums stammen vom Beginn des 16. Jahrhunderts und zu dem Zeitpunkt gab der Braucht, beim Bau eines Hauses einen Baum aufzustellen bereits etabliert. Bäume spielen ja auch bei anderen Festen eine Rolle, der Maibaum ist ein bekanntes Beispiel. Da gibt es offenbar Parallelen. Bäume waren als Rohstoff schon immer sehr wichtig. Aus Holz wurden Häuser nicht nur gebaut, sondern mit Holz wurden die Häuser natürlich auch geheizt. Das ganze Leben hing somit von Bäumen ab.Nadelbaum: standhaft, immergrün und Sinnbild des Lebens
Was symbolisiert nun der Baum? Festigkeit, Standhaftigkeit, Langlebigkeit – und das hat man sich sicherlich auch von den neu gebauten Häusern gewünscht. Außerdem werden meist Nadelbäume verwendet. Weil diese immergrün sind, gelten sie auch als ein Sinnbild des Lebens und der Fruchtbarkeit. Insofern war mit dem Richtbaum sicher auch die Hoffnung verbunden, dass er den Bewohnern des Hauses ein gesundes Leben beschert und sie vor Krankheit schützt.Gute (Wald-)Geister sollen weiterleben und das Haus schützen
Martin Rieger, Bauingenieur und Zimmermann aus Sigmaringendorf hat, sich mit dieser Frage auch viel beschäftigt und einen weiteren Punkt ins Spiel gebracht: Viele germanische und skandinavische Mythen erzählen davon, dass die Seelen der Menschen von den Bäumen kamen und nach dem Tod die Seelen wieder in den Bäumen aufgehen. Der Wald war also beseelt, dort lebten nach der Vorstellung der Menschen gute und böse Geister. Weil aber nun zum Hausbau Bäume gefällt wurden, wollte man diese Geister möglicherweise durch das symbolische Anbringen eines Baumwipfels milde stimmen und sich bei ihnen "bedanken". Die guten Geister sollten durch das Anbringen des Richtbaumes weiterleben.Wed, 20 Jul 2022 - 02min - 5517 - Wohin dehnen sich verschweißte Eisenbahnschienen bei Hitze aus?
Heute sind die Schienen verschweißt, aber früher gab es zwischen den Schienen kleine Lücken, damit sie sich ausdehnen konnten. Darum hörte man, wenn man mit der Bahn gefahren ist, immer dieses „Dadammdadammdadamm“. Um herauszufinden, wie das Problem gelöst wurde, habe ich bei der Bahn nachgefragt. Die Auskunft war folgende: Seit diese Schienen verschweißt werden, leitet man die Ausdehnungskräfte vor allem in den Untergrund ab. Es spielt aber auch eine Rolle, wie die Schienen verschweißt sind: An den Verbindungsstellen entstehen durch die Ausdehnung große Kräfte. Das Material, mit dem die Schienen verschweißt sind, kann Temperaturen zwischen –20°C und +60°C aushalten, ohne dass das Material bricht. Das also ist die Erklärung der Bahn, warum die Schienen so gut halten und auch verschweißt werden können ohne zu bersten, wenn es zu heiß wird.
Wie können lange Schienen die Spannung nach unten abgeben?
Die Schienen sind tatsächlich so fest verschweißt und so fest an den Bahnschwellen befestigt, dass die sich – zumindest in der Länge – überhaupt nicht mehr ausdehnen können. Die Spannungen, die auftreten, werden daher z. T. vom Material selbst getragen – das Material hält das also intern aus – oder die Spannungen werden nach unten abgegeben. Die Schiene dehnt sich somit nicht in die Länge aus, sondern ein Stück in die Tiefe – so die Erklärung der Bahn. Es ist ja auch immer die Frage: Was ist stärker? Wenn das Material sich ausdehnt, dabei jedoch am Ausdehnen gehindert wird, weil es fest verankert ist, dann entsteht ein sehr hoher Druck, eine sehr hohe Spannung im Material. Das geschieht auch an den Verschweißungsnähten. Aber wenn das Material diese Spannung aushält, ist es auch gut.Thu, 2 Jun 2022 - 03min - 5516 - Was ist der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer?
Oberbegriff: Demenz
Demenz ist der Oberbegriff. Es gibt ganz viele verschiedene Demenzerkrankungen. Die Alzheimer-Demenz ist mit circa zwei Drittel bis drei Viertel der Fälle die häufigste Form einer Demenzerkrankung. Das heißt: Jeder Mensch, der Alzheimer hat, ist dement. Aber wer dement ist, muss nicht unbedingt Alzheimer haben.Fri, 19 Mar 2021 - 00min - 5515 - Führt der Klimawandel zu mehr Erdbeben?
Kurzfristig nein, langfristig möglicherweise. Die Überlegung ist völlig berechtigt. Was passiert denn, wenn zum Beispiel auf Grönland die schweren Gletscher schmelzen? Die haben ein Gewicht von Tausenden von Milliarden Tonnen. Das Gleiche trifft für die Antarktis zu oder – im kleineren Umfang – auch auf die Gletscher in den Alpen oder auf Island. Wenn diese Gletscher abschmelzen, werden die darunterliegenden Landmassen entlastet. Nun ist es ja so: Die Kontinentalplatten kann man sich tatsächlich als Platten vorstellen, die auf einer zähflüssigen heißen Gesteinsmasse schwimmen. Wenn sie von oben durch das Eis zusätzlich belastet werden, passiert das Gleiche wie bei einer kleinen Eisscholle, wenn sich ein Eisbär draufsetzt: Es drückt die Scholle nach unten. Wenn der Eisbär runtergeht von der Scholle, steigt sie wieder auf. Und so ist es mit den Kontinentalplatten: Wenn die Eismassen schmelzen, steigen sie auf. Das geht allerdings sehr langsam.
Letzte große Eiszeit endete vor 10.000 Jahren, Platten steigen noch heute
Seitdem sind schon viele Gletscher geschmolzen. Als Reaktion auf diese Entlastung steigen heute noch die entsprechenden Landmassen auf. Skandinavien, Schottland und Dänemark zum Beispiel heben sich noch heute um bis zu einen Meter in 100 Jahren. Das ist eine ganz langsame kontinuierliche Landhebung; es bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass es zu Erdbeben kommt. Man kann sich aber vorstellen, dass es durchaus zu Erdbeben führen kann, wenn die Erdkruste durch die Entlastung erst mal in Bewegung gerät. Zwar gibt es bislang dafür kaum Anzeichen. Es gab aber vor wenigen Jahren eine Untersuchung von Geophysikern aus Münster und Bern, die Hinweise auf einen solchen Zusammenhang in Amerika gefunden haben. Auch da lagen in der Eiszeit mächtige Gletscher und es sieht so aus, als habe die große Gletscherschmelze am Ende tatsächlich dazu geführt, dass an einigen geologischen Störungen gehäuft kleinere Erdbeben stattfanden. Jetzt kommt aber die Einschränkung: Das ist nicht von jetzt auf gleich passiert, sondern diese Reaktion kommt mit Jahrtausenden Verzögerung. Und es passiert dort, wo vorher die Gletscher lagen und nicht irgendwo anders auf der Welt. Man kann also nicht – was Sie in Ihrer Frage vermutet haben – die Beben in Haiti oder Chile oder den Vulkanausbruch auf Island auf den aktuellen Klimawandel zurückführen. Wir erleben zwar seit einigen Jahrzehnten einen schnellen Klimawandel; die Gletscher schmelzen. Aber das hat bisher noch nicht dazu geführt, dass wir jetzt insgesamt auf der Welt mehr Erdbeben hätten als im Mittelalter oder in der Antike.Tue, 19 Dec 2023 - 03min - 5514 - Was würde passieren, wenn der Mond weg wäre?
Ohne Mond keine verlässlichen Jahreszeiten
Ohne den Mond hätten wir keine verlässlichen Jahreszeiten. Denn der Mond stabilisiert die Erdachse. Gäbe es ihn nicht, geriete die Erdachse alle paar Millionen Jahre kräftig ins Trudeln. Mit verheerenden Auswirkungen auf das Klima. Forscher haben ausgerechnet: Ohne Mond könnte die Erdachse zwischendurch auch mal um fast 90 Grad kippen. Dann könnte ganz schnell mal der Nordpol in den Tropen liegen. Das würde bedeuten: Jede Erdhälfte hätte ein halbes Jahr lang pralle Sonne und anschließend ein halbes Jahr lang finsterste Nacht. Der Mond dagegen hält die Erdachse einigermaßen in Position, sodass es solche extremen Verhältnisse nicht geben kann.Wichtige Rolle bei der Evolution
Ohne den Mond wären die Kontinente vielleicht noch immer unbelebt und alles Leben würde sich im Meer abspielen. Denn der Mond bringt uns Ebbe und Flut, und somit auch die Überschwemmungsgebiete an der Küste, im Übergang zwischen Wasser und Land. Große Flächen, die zweimal am Tag geflutet werden und zwischendurch trockenfallen. Diese Übergangsbereiche spielten in der Evolution eine wichtige Rolle: Hier entwickelten sich die Amphibien, die später weiter an Land krochen und aus denen sich schließlich Echsen, Saurier und Säugetiere entwickelten. Ohne Mond wären Ebbe und Flut viel schwächer, und diese ganzen Überschwemmungsgebiete hätte es in der Form nicht gegeben.Ohne den Mond wären die Tage kürzer
Ohne den Mond wären auch die Tage kürzer. Heute braucht die Erde 24 Stunden, um sich einmal um sich selbst zu drehen. In ihrer Frühzeit drehte sie sich viermal so schnell; ein Tag dauerte entsprechend nur 6 Stunden. Es war der Mond, der die Erde gebremst hat: Durch die Gezeiten, die er auslöst, durch Ebbe und Flut und dieses ganze Hin- und Hergeschwappe, verliert die Erde ständig an Dreh-Energie und rotiert infolgedessen immer langsamer. Ohne den Mond wäre es nachts auch nicht nur dunkel, sondern stockdunkel, und zwar jede Nacht. Nur die Sterne könnten uns noch den Weg leuchten. Ohne den Mond wäre die Erde auch einsamer – so ohne Begleiter. Das Traurige an der Geschichte: Der Mond entfernt sich von uns. Jedes Jahr driftet er 4 cm weiter hinaus ins Weltall. Eines fernen Tages wird er so weit weg sein, dass es keine totale Sonnenfinsternis mehr geben wird.Fri, 8 Sep 2023 - 02min - 5513 - Warum bewegen sich Wolken manchmal in verschiedene Richtungen?
3 "Stockwerke": Wolken sind in unterschiedlichen Höhen unterwegs
Das passiert meist dann, wenn sich Wolken in unterschiedlichen Höhen befinden, es also sowohl tiefhängende Wolken gibt als auch welche in höheren Luftschichten. Denn die Windrichtung ändert sich mit der Höhe. Ganz grob kann man dabei in der Atmosphäre drei "Stockwerke" unterscheiden. Ich fange mal im "Dachgeschoss" an, das befindet sich 9 bis 12 Kilometer über der Erde. Dort sind vor allem Cirruswolken unterwegs. Das sind die feinen Federwolken vor meist blauem Himmel, also die typischen Schönwetterwolken. Diese Wolken bewegen sich etwa in der Höhe, in der auch Flugzeuge fliegen und ihre Kondensstreifen hinterlassen. In dieser Höhe weht in unseren Breiten ein sehr starker Wind, der sogenannte Jetstream; er weht relativ kontinuierlich von West oder Nordwest. Entsprechend bewegen sich Cirruswolken und Kondensstreifen ebenfalls meist in diese Richtung.Nordhalbkugel: Winde wehen tendenziell von West nach Ost
Dass der Jetstream grob Richtung Osten weht, hängt mit der Erddrehung zusammen. Ganz grob gesagt: Eigentlich "will" der Wind vom warmen Äquator zum kalten Nordpol, also von Süden nach Norden. Aber wegen der Erddrehung werden alle Wind auf der Nordhalbkugel nach rechts abgelenkt. Deshalb weht der Jetstream am Ende von West nach Ost. Wie das genau zusammenhängt, habe ich in einer anderen 1000-Antworten-Folge erklärt: "Warum weht der Wind überwiegend aus dem Westen?Hoch- oder Tiefdruckgebiet? – Winde wehen in verschiedene Richtungen
Zurück zum Jetstream auf 9.000 bis 12.000 Metern Höhe. Darunter befindet sich ein relativ ausgedehntes Stockwerk. Das ist das, wo sich die Dynamik des Wetters hauptsächlich abspielt. Dort bewegen sich nämlich die Hoch- und Tiefdruckgebiete, die wir von den Wetterkarten als kreisförmige Gebilde kennen. Sie erscheinen deshalb kreisförmig, weil sich hier der Wind tatsächlich kreisförmig um sie herumweht. Um Hochdruckgebiete weht er dabei im Uhrzeigersinn, um Tiefdruckgebiete gegen den Uhrzeigersinn – zumindest auf der Nordhalbkugel der Erde. Entsprechend bewegen sich auch da die Wolken. Oft weht der Wind auch hier aus Westen, oft aber auch aus anderen Richtungen – je nachdem, wie die Hoch- und Tiefdruckgebiete gerade unterwegs sind und wo sich in dieser Gemengelage gerade mein Standort befindet. Wenn wir jetzt eine Situation haben, in der es Wolken in beiden Stockwerken gibt, also zum Beispiel Cirruswolken oben in Flughöhe und Haufenwolken darunter, dann kann es sein, dass die Winde in den verschiedenen Höhen in unterschiedliche Richtungen wehen und entsprechend auch die Wolken sich in unterschiedliche, vielleicht sogar entgegengesetzte Richtungen bewegen. Aber es gibt noch ein weiteres Stockwerk. Das ist das, was uns am nächsten ist – nämlich die ersten 1.000 bis 1.500 Meter über der Erdoberfläche. Das ist das "Erdgeschoss" der Atmosphäre. Diese Schicht ist dadurch gekennzeichnet, dass die Winde sich an der Erdoberfläche reiben und dadurch abgebremst werden. Ich hatte gesagt, dass die Winde auf der Nordhalbkugel wegen der Erddrehung immer nach rechts abgelenkt werden – dieser Effekt wird auch als Corioliskraft bezeichnet – und der ist umso größer, je schneller der Wind weht. Wird der Wind in Bodennähe also abgebremst, wird er nicht mehr so stark abgelenkt. Im Vergleich zu dem Stockwerk darüber weht der Wind deshalb weiter nach links, und das kann als Winkel bis zu 45° aus machen. Genau das machen sich Ballonfahrer zunutze, denn das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie ein Heißluftballon zumindest ein bisschen navigieren kann: Will ich weiter nach rechts, werfe ich Ballast ab, sodass ich in Schichten aufsteige, in denen der Wind weiter nach rechts weht. Wenn ich weiter nach links will, lasse ich Gas ab, sodass ich sinke.Unterschiedliche Windverhältnisse lassen Wolken in verschiedene Richtungen driften
Betrachten wir jetzt nochmal unsere Wolken: Im Erdgeschoss der Atmosphäre weht der Wind bis zu 45° schräg im Vergleich zum Wind im ersten Geschoss. Und im Dachgeschoss kann er nochmal ganz anders wehen. Deshalb können die Wolken in den verschiedenen Luftschichten in unterschiedliche Richtungen driften.Wed, 30 Aug 2023 - 04min - 5512 - Wie entsteht ein Akku-Brand?
Hohe Energiedichte
Lithium-Ionen-Akkus haben eine hohe Energiedichte, deshalb sind sie so gut geeignet für leistungsstarke Geräte wie E-Bikes, Notebooks oder auch für selbstfahrende Rasenmäher. Die hohe Energiedichte hat jedoch eine Schattenseite, und das ist die zwar statistisch geringe, aber eben doch vorhandene Brand- und Explosionsgefahr, wenn im Akku die Dinge außer Kontrolle geraten, es zu einem Kurzschluss kommt und sich die viele Energie sozusagen auf einen Schlag entlädt.Bei Beschädigung droht Kurzschluss
Dabei passiert Folgendes: Wie jede normale Batterie hat ein Akku zwei Kammern, eine auf der Anoden- eine auf der Kathodenseite. Zwischen diesen beiden Kammern strömen die Ladungsträger – in dem Fall die Lithium-Ionen – hin- und her, in die eine oder in die andere Richtung, je nachdem, ob der Akku gerade genutzt oder wieder aufgeladen wird. Damit das kontrolliert passiert, befindet sich zwischen den Kammern der sogenannte Separator, eine halbdurchlässige Trennwand. Halbdurchlässig bedeutet, die Ladungsträger im Akku – also die Lithium-Ionen – können den Separator durchdringen, aber nur langsam und wohldosiert. Wenn der Separator beschädigt ist – sei es durch übermäßige Hitze, sei es, weil er auf einen harten Boden gefallen oder einfach durch einen Produktionsfehler –, wird diese Trennwand für die Lithium-Ionen durchlässiger als sie sein sollte. Das heißt im Klartext: Es gibt einen Kurzschluss. Der führt dazu, dass die Lithium-Ionen sehr schnell durch den Akku wandern und es sehr schnell zu chemischen Reaktionen kommt, bei denen in kurzer Zeit sehr viel Energie freigesetzt wird. Das führt zu einer Kettenreaktionen: Je heißer der Akku wird, desto eher geht erstens der Separator noch mehr kaputt und desto schneller laufen zweitens die Reaktionen ab, sodass durchaus Temperaturen von über 1.000 °C entstehen können. Man muss sagen: Das Risiko, dass ein Akku Feuer fängt, ist insgesamt gering, kleiner als 1:1.000.000. Aber dadurch, dass es inzwischen viele Millionen Lithium-Ionen-Akkus gibt, kommt es eben immer mal wieder vor.Wie kann man Akku-Brände vermeiden?
Es gibt ein paar Vorsichtsmaßnahmen, mit denen sich das Risiko verringern lässt. Dazu gehört, Akkus immer mit den Geräten zu laden, die dafür vorgesehen sind. Und zwar bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C. Ist es zu kalt oder zu warm, erhöht sich die Kurzschluss-Gefahr. Wenn Lithium-Ionen-Akkus länger nicht genutzt werden – also etwa beim E-Bike in der Winterpause – den Akku vom Gerät entfernen und einigermaßen kühl lagern, und zwar am besten, wenn er halb voll geladen ist. Ist der Akku zu leer, besteht bei längerer Lagerung die Gefahr einer Tiefentladung – auch das erhöht beim Wiederaufladen die Brandgefahr. Wird der Akku aus einer kalten Garage geholt, lässt man ihn am besten bei Zimmertemperatur sich aufwärmen. Und beim ersten Wiederaufladen empfiehlt es sich, in der Nähe zu bleiben und immer mal wieder gucken, ob alles in Ordnung ist.Wie löscht man einen Akku-Brand?
Hat der Akku jedoch einmal Feuer gefangen, lautet die Regel: Nicht versuchen, ihn mit Wasser zu löschen! Denn das kann die eigentliche Explosion erst auslösen. Wegen der großen Hitze können sich nämlich Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Und freier Wasserstoff ist hochgefährlich, dann kommt es zur Knallgasreaktion. Besser geeignet ist Löschpulver, was in guten Feuerlöschern auch enthalten ist. Und am besten gleich die Feuerwehr rufen.Sun, 27 Aug 2023 - 03min - 5511 - Können Haustiere Gewitter vorab spüren?
Der "sechste Sinn" bei Tieren ist nur eine Legende
Einen wissenschaftlichen Beweis für so einen höheren Sinn gibt es aber bis heute nicht. Tiere brauchen einen solchen zusätzlichen Sinn auch gar nicht – die Sinne, die sie haben, reichen vollkommen aus, um ein Gewitter frühzeitig zu erkennen. Und zwar früher als wir das tun, denn ihre Sinne sind dafür viel geschärfter.Naturphänomene besser hören, spüren – und vielleicht sogar riechen?
Wie nehmen sie jetzt also das Gewitter wahr? Sie können erstens mit ihren gespitzten Ohren viel früher als wir den Donner hören, wenn das Gewitter noch weiter weg ist. Zweitens geht man auch davon aus, dass sie ein herannahendes Gewitter richtig fühlen können, weil sich da nämlich der Druck der Luft ändert. Und es gibt sogar Theorien, dass Hunde und Katzen Unwetter auch riechen können – und zwar nicht nur den Regen, sondern auch die Blitze, die einen metallischen Geruch in der Luft hinterlassen sollen. Was es jetzt genau ist, das die Vierbeiner vorwarnt, kann natürlich keiner sagen – dafür müssten wir sie schon selbst fragen. Aber wir sehen: Sie bekommen es schneller mit als wir das tun.Vulkanausbruch und Erdbeben: Auch hier zeigen Tiere vorab Auffälligkeiten
Und das ist nicht nur bei Gewittern so: Tatsächlich wurde schon häufig beobachtet, dass Tiere sich auch vor Naturkatastrophen auffällig verhalten – zum Beispiel vor Vulkanausbrüchen oder Erdbeben. Da vermutet man, dass sie auf bestimmte Veränderungen in der Natur vor einem Beben reagieren. Man weiß aber noch nicht so genau, welche Veränderungen das sind. Aber sie scheinen uns Menschen und auch den Messgeräten zu entgehen.Tiere bald als "Warnsystem"? – Forschung analysiert auffälliges Tierverhalten
Tierbeobachter nutzen das auffällige Verhalten von Tieren sogar, um frühzeitig vor der nahenden Katastrophe zu warnen. In China konnten so in den 1970ern sogar einmal tausende Menschen vor einem Erdbeben gerettet werden. Da sind nämlich kurz davor zahlreiche Schlangen auffällig früh aus ihrem Winterschlaf erwacht. Das wurde gemeldet und die Behörden haben einen Katastrophenalarm ausgelöst. Das klappt manchmal – zuverlässig ist das aber leider trotzdem nicht. Dafür verhalten sich die Tiere viel zu häufig auffällig, und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Deshalb muss man die Verhaltensarten noch weiter untersuchen – auch bei uns in Deutschland gibt es da gerade Versuche, bei denen das Verhalten von Hunden und Katzen mit Halsbändern getrackt wird. So wollen die Forschenden sehen, ob auch unsere Haustiere auf Erdbeben reagieren – dazu weiß man gerade noch wenig.Wed, 23 Aug 2023 - 02min - 5510 - Sind Algen Pflanzen?
Viele Unterschiede zwischen Algen und Pflanzen
Es gibt verschiedene Definitionen, aber in der Regel werden die Algen nicht zu den Pflanzen gezählt. Unstrittig ist auf jeden Fall die evolutionäre Verbindung: Es waren Grünalgen, aus denen vor Urzeiten die ersten Landpflanzen hervorgegangen sind. Das waren damals vor allem Moose. Unstrittig sind auch die Gemeinsamkeiten: Algen betreiben Photosynthese, genau wie Pflanzen – sie nutzen also Sonnenlicht, um zu wachsen. Speziell die Grünalgen nutzen dafür auch die gleichen Arten von Zellbestandteilen, nämlich die Chloroplasten. Aber es gibt eben auch große Unterschiede: Algen sind viel einfacher gebaut als Landpflanzen, Algen haben keine Wurzeln, keinen Stamm oder Stängel. Das alles brauchen sie nicht, denn sie sind ja von Wasser umgeben. Die Fortpflanzung läuft auch anders ab: Pflanzen sind „Embryophyten“. Sie bilden Samen, über die sie sich vermehren. Algen dagegen vermehren sich hauptsächlich über Zellteilung und über Sporen. Und bei den Algen gibt es auch viele einzellige Arten. Meist denken wir zuerst an die großen Algen, die an die Strände gespült werden oder im Wasser treiben und die man in die Hand nehmen kann. Das sind die sogenannten Makroalgen. Aber für die Meeresökologie fast noch wichtiger sind die einzelligen Algen, die Mikroalgen, die man mit bloßem Auge gar nicht erkennt. Das wird auch Phytoplankton genannt.Mikroalgen: Einzellige Algen unterscheiden sich klar von Bakterien
Diese einzelligen Algen haben mit Landpflanzen noch weniger Ähnlichkeit. Früher hat man die eher mit Bakterien verwechselt. Noch immer kursiert der Ausdruck Blaualge für bestimmte Einzeller, die aber in Wirklichkeit keine Algen, sondern Bakterien sind und heute als Cyanobakterien bezeichnet werden. Der Unterschied zwischen Bakterien und einzelligen Algen ist ganz klar: Algen haben einen Zellkern, Bakterien nicht. Das ist ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal.Algen sind Protoctisten
Weil sich nun Algen sowohl ganz klar von Bakterien als auch recht stark von Landpflanzen unterscheiden, werden sie in der Biologie einer Art „Zwischenreich“ zugeordnet, nämlich den Protoctisten – das ist ein eigenes biologisches Reich irgendwo zwischen den Bakterien und den noch höheren Organismen, also Pflanzen, Tieren und Pilzen. Zu diesen Protoctisten gehören zum Beispiel auch Wimperntierchen und Schleimpilze. Es gibt allerdings auch Definitionen, wonach Algen in einem weiteren Sinn doch zu den Pflanzen gerechnet werden. In dieser Logik bestehen Pflanzen aus Landpflanzen einerseits und Algen andererseits. Das hat auch damit zu tun, dass die Algenkunde traditionell aus der Botanik, also der Pflanzenwissenschaft, hervorgegangen ist. In der Natur sind die Übergänge nun mal fließend – insofern sind verschiedene Definitionen möglich. Nach der vorherrschenden sind Algen aber keine Pflanzen.Algen blühen nicht
Man hört auch immer wieder von "Algenblüten", darf sich davon aber nicht täuschen lassen: Algen blühen nicht; es gibt keine Blüten. Der Begriff "Algenblüte" bezeichnet lediglich ein explosionsartiges Algenwachstum, das in den Weltmeeren immer mal wieder vorkommt. In den letzten Jahren sogar immer häufiger.Thu, 11 Apr 2024 - 02min - 5509 - Wie wird das Wirtschaftswachstum gemessen?
Um das Wirtschaftswachstum auszurechnen, muss erstmal das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ermittelt werden – denn das ist die Definition: Das Wirtschaftswachstum beschreibt, wie stark das Bruttoinlandsprodukt gewachsen ist – zum Beispiel innerhalb eines Quartals im Vergleich zum Vorquartal. Das BIP kann natürlich auch schrumpfen. Wie aber rechnet man das Bruttoinlandsprodukt aus? Unter das BIP fällt alles, was in unserer Volkswirtschaft innerhalb dieses Zeitraums an Waren und Dienstleistungen produziert wurde. Genauer gesagt, der geschaffene Mehrwert. Das bedeutet: Wenn ein Brötchen verkauft wird, dann werden davon unter anderem die Kosten für das eingekaufte Mehl und andere Zutaten abgezogen. Damit nicht doppelt gezählt wird. Die Wertschöpfung der einzelnen Wirtschaftsbereiche wird zusammengerechnet und dann kann man vergleichen, wie sich die Wirtschaftsleistung verändert hat. Wichtig: Natürlich wird wegen der Inflation alles teurer, also auf dem Papier auch "mehr wert". Aber Preissteigerungen werden beim Wirtschaftswachstum rausgerechnet. Ist die Summe der Werte aller Waren und Dienstleistungen gestiegen, zeigt sich, um wie viel Prozent – und das ist dann das Wirtschaftswachstum. Das klingt relativ einfach – aber es ist in der Praxis ein ganz schöner Aufwand: Und den betreibt das Statistische Bundesamt: Es erstellt hunderte amtliche Statistiken, auch mit Hilfe der Statistischen Landesämter. Dafür werden zum Beispiel Unternehmen regelmäßig aufgefordert, Zahlen zu melden. Welche Firmen das konkret sind, wechselt und es ist geheim. Aber die Statistikämter stellen nach eigenen Angaben sicher, dass die Auswahl repräsentativ ist. Sagen wir mal, es wäre eine Firma dabei, die Baumaschinen herstellt. Dann geht es bei den Daten zum Beispiel darum, wie viel Umsatz mit den hergestellten Maschinen gemacht wurde und welche Kosten dabei angefallen sind. Das Bruttoinlandsprodukt wird aber auch von anderer Seite her nochmal gemessen: Und zwar: Wie wurden die Waren und Dienstleistungen verwendet – für den Konsum, als Investition in einem Unternehmen oder als Exportartikel. Nehmen wir einen Laptop: Der kann für den privaten Gebrauch gekauft werden, als gewerblich genutztes Gerät oder er könnte ins Ausland exportiert werden. Das ist wichtig, wenn man wissen will, worauf ein Wirtschaftswachstum konkret zurückgeht. Am Ende werden diese beiden Rechenwege miteinander abgeglichen – also, was wird in der Summe an Waren und Dienstleistungen produziert und: wie werden sie verwendet. Das hilft, um das Bruttoinlandsprodukt so genau wie möglich zu berechnen. Die erste Berechnung für das BIP wird immer 30 Tage nachdem ein Quartal abgelaufen ist veröffentlicht. Das Ergebnis hören, sehen oder lesen wir dann in den Nachrichten.
Was viele aber nicht wissen: Danach wird mehrfach neu gerechnet – einfach, weil viele amtliche Statistiken erst später vorliegen. Übrigens: In das BIP fließen hauptsächlich die Werte an Waren und Dienstleistungen ein, die auch auf dem Markt gehandelt werden. Das heißt, wenn jemand zu Hause seine Eltern oder Kinder betreut, statt eine Betreuungseinrichtung zu nutzen, dann fließt diese Leistung nicht in das Bruttoinlandsprodukt ein. Wohl aber staatliche Leistungen wie Polizei, Justiz oder Verwaltung. Der Wert dieser Dienstleistungen wird vor allem über die Personalkosten im Bruttoinlandsprodukt berücksichtigt.Sun, 13 Aug 2023 - 03min - 5508 - Warum haben wir das Gefühl, Influencer wirklich zu kennen?
Gefühl von Nähe durch regelmäßige Medien-Kontakte und lockere Atmosphäre
In den 1950ern haben sich Menschen bereits eine ganz ähnliche Frage gestellt. Ihnen ging es dabei allerdings noch nicht um Influencer, wie wir sie heute kennen, sondern um Fernsehstars. Denn damals gab es immer mehr Menschen, die einen Fernseher hatten. In den Fernsehshows standen vor allem einzelne Personen im Mittelpunkt. Das waren zum Beispiel Moderatorinnen und Moderatoren in einer Talkshow. Oder auch fiktive Personen in Filmen. Und damals hat man schon festgestellt: Die Menschen vor dem Fernseher hatten das Gefühl, eine Beziehung mit den prominenten oder fiktiven Personen zu haben. Die Zuschauenden fühlten sich durch den regelmäßigen Kontakt und die vermittelte lockere Atmosphäre den Prominenten so nahe, als ob sie wirklich miteinander befreundet wären."Parasoziale Interaktion": Phänomen bereits seit den 1950ern bekannt
Diese Erkenntnis formulierten 1956 zwei Amerikaner – Donald Horton und R. Richard Wohl. Sie nannten den Effekt "parasoziale Interaktion". Diese Studie ist bis heute die Grundlage für das Erforschen solcher Beziehungen. Besonders spannend war die Erkenntnis auch deshalb, weil eigentlich angenommen wurde, dass Zuschauer sich sehr stark mit den Figuren aus dem Fernsehen identifizieren, sich also an ihre Stelle denken. Das ist aber weniger der Fall als angenommen. Sie verhalten sich eher so, als seien diese Figuren reale Freundinnen und Freunde.Gefühlte Nähe, ausgelöst durch Bindungshormon Oxytocin, bleibt eine Illusion
Und so ist es auch heute mit Influencern. Auch zu denen bauen viele Menschen eine "parasoziale Beziehung" auf. Ein wichtiger Unterschied zu Beziehungen mit realen Freundinnen und Freunden ist, dass die Interaktion meist nicht wechselseitig ist. Die gefühlte Nähe ist eine Illusion. Doch die Hormone, die diese Gefühle auslösen, sind ganz real. Das sogenannte Bindungshormon Oxytocin wird bei persönlichen Kontakten zwischen Menschen freigesetzt und sorgt für ein Gefühl von Bindung und Vertrauen. Dieses Oxytocin wird auch bei parasozialen Beziehungen und Interaktionen freigesetzt. Was die Fernsehstars früher machten, um das Gefühl von Intimität aufkommen zu lassen, machen auch die Influencer heute: Ihre Sprache, die lockere Haltung und ihre Spontanität wirken wie in einer privaten Unterhaltung.Influencer und Fan: Social Media ermöglicht wechselseitige Beziehungen
Was sich jedoch seit den 1950ern geändert hat: Durch die sozialen Medien kann manchmal aus einer einseitigen Beziehung auch eine wechselseitige werden. In Kommentaren unter YouTube-Videos, TikToks oder Posts auf Instagram schreiben die Fans mit ihren Idolen. Aber häufig bleibt ein solcher Kommentar auch unbeantwortet. Dass Influencer häufig sehr private Einblicke in ihren Alltag geben – oder es zumindest vorgeben – spielt beim Aufbau von parasozialen Beziehungen auch eine wichtige Rolle. Allerdings sollte klar sein: Sobald wir Medien nutzen, interagieren wir parasozial mit den Influencern, Fernsehstars und fiktiven Figuren.Beziehung ohne Verpflichtungen
Ob daraus eine parasoziale Beziehung entsteht, hängt auch von der Persönlichkeit derer ab, die die Medien nutzen. Man hat herausgefunden: Menschen, die eher introvertiert sind oder weniger reale soziale Kontakte haben, neigen eher zu parasozialen Beziehungen. Solche Beziehungen haben nämlich einen Vorteil: Es sind Beziehungen ohne Verpflichtungen. Man hat das Gefühl, "Freunde" zu haben, ohne dass es mit irgendeiner Verantwortung verbunden wäre. Gleichzeitig ist der Influencer ein scheinbar verlässlicher Beziehungspartner in einer Welt voller Veränderungen und vermittelt so ein Stück Stabilität. Darum ist eine parasoziale Beziehung für alle Menschen relevant, egal wie alt sie sind. Doch besonders interessant sind diese Beziehungen für Menschen, die Orientierung in einer unsicheren Phase suchen, also zum Beispiel für Jugendliche in der Pubertät.Thu, 10 Aug 2023 - 03min - 5507 - Warum erinnern sich Mütter schlecht an die Kindheit der eigenen Kinder?
Stilldemenz: Konzentration der Mutter ist ganz aufs Kind gerichtet
Das ist ganz unterschiedlich, aber das sind tatsächlich spannende Fragen. Wenn die Kinder noch ganz klein sind, sind die Beanspruchung des Körpers und die Aufmerksamkeit so stark auf das Kind gerichtet, dass man hier auch von einer Stilldemenz spricht. Man kann also tatsächlich sehen, dass in den Wochen und Monaten nach der Geburt eines Kindes die Anzahl der synaptischen Kontakte in einem Gehirn, das in einem Körper sitzt, der ein Kind zur Welt gebracht hat, erniedrigt sind. Das bedeutet, dass die Lernfähigkeit und damit auch das Erinnerungsvermögen in dieser Zeit eingeschränkt sind und die volle Aufmerksamkeit eben anderen Aufgaben gilt. Das hält allerdings nicht lange an und ist, zur Beruhigung der Betroffenen, vollkommen reversibel. Man kriegt alles wieder, was man in die Kinder investiert hat.Vieles kann mithilfe von Fotos oder Gesprächen doch noch erinnert werden
Man merkt das auch daran, dass man das, was man aktiv nicht erinnert hat, doch noch gespeichert hat – wenn man Filme aus der Zeit sieht, Fotos anschaut oder wenn Freunde vorbeikommen, die man lange nicht gesehen hat. Die sagen man: "Als der noch klein war, war doch dies und jenes passiert." Und auf einmal denkt man: "Stimmt, da war doch was." Und dann kann man die ganze Episode auch wiedergeben. Es ist also viel mehr da, als wir bewusst abrufen können. Aber in der Tat: Direkt nach der Geburt, aber vor allem auch, wenn man zwei Kinder hat, eins vielleicht noch in den Windeln auf dem Arm, das andere rennt schon weg – das sind Situationen, die die Aufmerksamkeit voll auf die Situation richten und nicht darauf, in der Situation etwas abzuspeichern. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist ständig geteilt zwischen dem, was wir selber tun, und der Beobachtung, was die Kinder gerade machen beziehungsweise den Alltag zu bewältigen. Bei geteilter Aufmerksamkeit ist es immer extrem schwierig, stabile Erinnerungen zu bilden.Im Vergessen liegt eine Chance fürs Kind
Für den Nachwuchs ist es eine große Chance, wenn die Eltern nicht in jedem Moment vor Augen haben, wie die Kinder früher waren. Denn dann sehen sie die Kinder so, wie sie jetzt sind – und nicht immer nur den kleinen Tollpatsch aus den frühen Kindertagen.Tue, 8 Aug 2023 - 03min - 5505 - Woher kommt das Wort "Tohuwabohu"?
"Und die Erde war wüst und leer"
Das Wort kommt aus der hebräischen Bibel, also dem "Alten Testament“, und zwar gleich aus dem zweiten Satz. Der erste lautet bekanntlich: "Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde" – "Bereschit bara Elohim et haSchamaim we‘et ha‘arez" – und dann geht es gleich weiter: "va ha‘arez hajita tohu vavohu." – "Und die Erde war wüst und leer." Dieses "wüst und leer“ ist somit nichts anderes als die Lutherübersetzung des biblischen "Tohuwabohu“ ("b“ und "v“ werden im Hebräischen durch den gleichen Buchstaben dargestellt).Bibelübersetzung: Martin Luther nahm sich sprachliche Freiheiten
"Tohu“ bedeutet so viel wie "leer“, "vohu“ entspricht dem deutschen Begriff "öde" oder eben "wüst". Und das "wa“ heißt einfach nur "und“. Also eigentlich steht da, strenggenommen nicht: "Die Erde war wüst und leer", sondern umgekehrt: "leer und wüst". Aber diese Freiheit der Umstellung hat sich Martin Luther genommen. Diesen Ursprung des Ausdrucks kennen heute viele nicht mehr – heute ist Tohuwabohu einfach ein Synonym für Chaos, was ja in der Bibel auch gemeint war: Die Welt war völlig unsortiert. Es gab keine Trennung von Land und Wasser, noch nicht einmal von Licht und Finsternis. Das war das Tohuwabohu der Bibel. Sprachlich interessant ist auch, dass der Bibeltext zwei klanglich ähnliche Wörter verwendet, eben "tohu“ und "bohu“. Das ist ein sprachliches Stilmittel, ein "Homoioteleuton“ – das kennen wir im Deutschen auch in Ausdrücken wie: "Klein, aber fein“, "richtig und wichtig“, "Lug und Trug. Aber diesen Gleichklang von Tohuwavohu ins Deutsche zu übertragen, das hat selbst der sprachverliebte Martin Luther nicht geschafft. Auf "wüst“ reimt sich nun mal nichts Passendes. Wenn man es drauf anlegt, könnte man texten: Die Erde war öde und schnöde … aber das trifft nicht wirklich den Zustand des Tohubabohu.Fri, 21 Jul 2023 - 01min - 5504 - Warum heißt Tee in manchen Ländern "Chai" oder "Cha"?
Verschiedene Varianten von "Tee" gehen aufs Chinesische zurück
Das ist ein interessantes Phänomen und erzählt viel über die Kolonialgeschichte. Tee heißt auf Persisch Chai, ähnlich klingt der Name im Arabischen oder im Türkischen – Çay. Aber Chay heißt er auch in Russland, der Ukraine und in den Balkanstaaten. Doch dann gibt es plötzlich eine Sprachgrenze. Auf Deutsch heißt er eben Tee, auf Englisch "tea". Auf Französisch, Spanisch, aber auch auf Schwedisch und Finnisch wird das Getränk zwar unterschiedlich geschrieben, aber überall mehr oder weniger immer als "Tee" ausgesprochen. So lassen sich fast alle Länder der Welt in zwei Schubladen sortieren. In der einen spricht man das Getränk "Te" oder so ähnlich aus. In der anderen ist es eine Variante von Chay, Cay oder Cha. Das ursprüngliche chinesische Wort war aber das gleiche, so erklärt es der Kieler Tee-Historiker Martin Krieger.Tee und Cha – das sind unterschiedliche chinesische Dialekte. Einige Kaufleute lernten Tee als "Tee" kennen, andere als "Tschai" oder "Tscha". Auf diese Weise entwickelten sich diese beiden Bezeichnungen für Tee und gingen um die Welt.
Quelle: Prof. Martin Krieger
"Chai" kam auf dem Landweg über Indien, Persien und Russland
Die Faustregel lautet: Dort, wo man Chai oder Tschai sagt, kam der Tee einst auf dem Landweg über Indien und Persien oder eben Russland an. Denn Cha war eigentlich sogar das gängigere Wort in China. Und als der Tee in Persien ankam, hatte er einen i-Auslaut verpasst bekommen, sodass aus "Cha" dann "Chai" wurde. Auf diesem Weg gelangte der Tee mit Karawanen noch weiter bis in die Türkei, den Balkan und den ganzen arabischen Raum. Deshalb heißt er fast überall dort Chai oder so ähnlich."Tee" erreichte Westeuropa per Schiff
Doch nach Westeuropa kam der Tee nicht auf dem Landweg, sondern über die Kolonialschiffe der Niederländer, Briten und Dänen. Die Niederländer waren die ersten, die Tee in großem Stil importieren, und deren Hauptanlaufstelle war in den Anfängen des Kolonialhandels die chinesische Südküste. Dort wurde die chinesische Sprache Min Nan gesprochen und in dieser Sprache klingt das Getränk eher wie Tee. Das haben dann auch die Briten und Dänen übernommen. Deshalb verrät der Name des Getränks in der Regel, ob ein Land den Tee ursprünglich über den Landweg oder den Seeweg bezogen hat. Hörtipp: SWR2 Wissen - Tee in der WeltgeschichteGegen die Regel: In Portugal heißt der Tee "Cha"
Doch es gibt eine interessante Ausnahme dieser Faustregel. Zwar ist ganz Westeuropa "Tee"-Land, doch ganz im Südwesten Europas, in Portugal, heißt der Tee plötzlich wieder "Cha". Das kommt daher, dass die Portugiesen in der Nachfolge von Vasco da Gama die ersten Europäer, die Schiffe ins ferne Asien schickten, noch vor den Niederländern. Sie beherrschten die asiatischen Meere im 16. Jahrhundert, ihr wichtigster Umschlagsplatz in China war aber Macau, und dort hieß der Tee nun mal "Cha", wie im überwiegenden Teil Chinas. Deshalb ist Portugal auf der europäischen Tee-Landkarte ein sprachlicher Ausreißer.Herbata und arbata: Polen, Litauen und Belarus leiten vom Lateinischen ab
Ein anderer findet sich Polen, Litauen und Belarus. Diese Länder passen teemäßig in keine der beiden Schubladen Tee oder Chai, sondern dort heißt der Tee herbata oder arbata. Da steckt das lateinische "Herba" drin – zu Deutsch "Kraut". Und tatsächlich war "Herba Thea" eine frühe botanische Bezeichnung für die Teepflanze. Die gibt es zwar nicht mehr, aber in Polen, Litauen und Belaraus hat sie sich gehalten, nur dass aus Herba Thea eben "Herbata" wurde.Fri, 14 Jul 2023 - 03min - 5503 - Wie verbessert man den Boden im Ökogarten?
Sauzahn statt Fräse: Boden nicht zu stark bearbeiten
Der Boden ist die lebende Grundlage für einen schönen Garten, daher müssen wir den richtig pflegen. Das erfordert keine starke Bodenbarbeiung wie umgraben oder fräsen. Das ist nicht notwendig. Außerdem holen wir dadurch den unteren, nicht lebendigen Boden nach oben und schaffen den lebendigen humusreichen Boden nach unten. Den Boden sollte man daher am besten mit einem Dreizahn oder einem Sauzahn bearbeiten. Der Sauzahn ist ein Gerät mit nur einem Haken. Wenn man den durch den Boden zieht, belüftet man den Boden.Mulch und dichte Bepflanzung: Boden möglichst bedeckt halten
Wichtig ist auch, den Boden immer bedeckt zu halten. In einem bedeckten Boden kann Leben wachsen. In einer Handvoll Erde sind so viele Lebewesen wie Einwohner auf der Erde – also ganz schön viele. Diese Lebewesen brauchen Futter in Form von organischem Material, also abgestorbenem Pflanzenmaterial. Am bekanntesten sind die Regenwürmer; die holen sich das organische Material hinunter in den Boden, verarbeiten es und scheiden es wieder aus. Das ist der beste Wurmkompost, den man sich vorstellen kann. Die Würmer durchlüften den Boden. Außerdem gibt es Millionen von Helfern aller Art, Mikroorganismen bzw. Kleinstlebewesen. Die arbeiten das ganze Jahr über den Boden um – futtern, arbeiten, futtern, arbeiten. Dafür brauchen sie einen bedeckten Boden. Wenn wir den Boden kahl machen und nackte Flächen lassen, kann sich darunter kein Leben entwickeln und kein Leben erhalten. Mulchen ist da super. Aber hilfreich ist auch, Pflanzen eng zu pflanzen, also möglichst dicht auf einer Fläche, sodass der Boden immer beschattet ist. Denn je besser der Boden beschattet ist, desto weniger Feuchtigkeit verliert er. Und je weniger Feuchtigkeit er verliert, desto mehr Leben kann im Boden entstehen.Sat, 10 Jun 2023 - 02min - 5502 - Warum ekeln wir uns vor Fäkalien und finden Toiletten besonders unhygienisch?
Ekelgefühl ist Schutzmechanismus
Mikrobiologisch ist die Toilette interessant, aber sie ist in einem normalen Haushalt nicht der unhygienischste Ort. Menschen denken beim Thema Hygiene als erstes an Toiletten, weil sie sich vor Fäkalien ekeln. Dieses angeborene Gefühl ist ein Schutzmechanismus und die Angst vor Fäkalien schützt uns vor Infektionskrankheiten. Interessanterweise ekeln sich Frauen mehr als Männer. Man begründet das damit, dass Frauen, vor allem in der Schwangerschaft, doppelt gut aufpassen müssen – auf sich und das ungeborene Kind. Es gibt nur wenige Dinge, vor denen sich alle Menschen auf der Welt ekeln. Das eine sind Leichen, also tote Menschen, und eben Fäkalien. Wovor man sich sonst ekelt – Insekten, Spinnen, gekochte Entenfüße – ist kulturell geprägt.Klo bietet wenig Spaß für Mikroorganismen
Die Fäkalien verschwinden sehr schnell in der Toilette und die Oberflächen sind zudem sehr glatt und werden mit sehr harter Chemie gereinigt. Nirgendwo sonst im Haushalt kommt so harte Chemie zum Einsatz wie in der Toilette. Andere Stellen wie die Toilettenbrille sind sehr trocken. Gespült wird in der Regel mit Trinkwasser, das sehr wenig Keime enthält. Für eine Mikrobe bietet eine Toilette daher nur wenig Spaß.Wed, 19 Jul 2023 - 02min - 5501 - Warum nimmt man den eigenen Körpergeruch kaum wahr?
Adaptation: Wir gewöhnen uns an Gerüche
Hier gilt das gleiche wie für alle Düfte, die man permanent um sich hat: Man nimmt sie irgendwann nicht mehr wahr. Das ist auch beim Parfüm so: Man trägt es auf, riecht es nach ein paar Minuten schon gar nicht mehr, sprüht nach – und am Schluss stinkt man wie ein Iltis. Die anderen merken es, man selber nicht. Wie alle Sinnessysteme hat unsere Nase die Fähigkeit, sich an bestimmte Reize zu gewöhnen und abzuschalten. Sie meldet dann dem Gehirn gar nicht mehr, dass Düfte in der Luft sind. Denn was die ganze Zeit da ist, muss dass Gehirn nicht ständig erfahren, sonst wird es völlig überlastet. Man nennt das Adaptation. In mancher Hinsicht ist das ein Geschenk, denn wenn es besonders stinkt, kann man sicher sein, dass man sich mit der Zeit auch daran gewöhnt und man diesen Duft nicht mehr riecht.Hunde laufen Zickzack, um die Spur nicht zu verlieren
Hunde können das übrigens auch. Wenn sie einer Beute folgen, laufen sie irgendwann Zickzack. Denn wenn sie immer in der Duftspur blieben, würden sie sich ebenfalls an den Geruch gewöhnen und den Hasen nicht mehr riechen können. Sie laufen also ein Stückchen raus, nehmen eine Prise frische Luft und kommen wieder zurück. Wenn wir einen Raum, in dem es stinkt, verlassen und wieder zurückkommen, bemerken wir auch den Geruch wieder.Sat, 8 Jul 2023 - 01min - 5500 - Welche Vorteile hat ein Hochbeet und wie legt man es an?
Hochbeet lässt sich gut kontrollieren
Obst- und Gemüseanbau gelingen problemlos. Am einfachsten geht das im Hochbeet. Das ist ein begrenzter Raum, der sich gut kontrollieren lässt. Dort kann ich wunderbar Salat anpflanzen – Rucola ist eine Pflanze, die ich immer gut ernten kann, die ist durchgängig einfach. Auch Radieschen und Rettich. In die Ecken des Hochbeets kann ich zum Beispiel Hängeerdbeeren setzen und remontierende Erdbeeren – die tragen das ganze Jahr. Wir haben heute für den Garten tolle Beeren-, Obst- und Gemüsesorten, die man leicht anpflanzen kann. Kleine Tricks sind hilfreich. Wenn man gerne Himbeeren isst, aber die kleinen Würmchen darin nicht mag, nimmt man einfach herbsttragende Pflanzen. Es geht immer darum, den Schädling auszuschalten. Im Herbst gibt es keine Würmer in den Himbeeren, denn die Himbeerfliege fliegt im Frühjahr. Wenn ich also auf diese Dinge achte, brauche ich gar keinen Pflanzenschutz. Und es funktioniert – auch wenn ich keinen grünen Daumen habe.Wie baut man ein Hochbeet?
Ein Hochbett geht ganz einfach. Man braucht einen Holzrahmen, in den füllt man unten grobes Material rein, also Holzschnitzel. Darauf kommt immer feineres Material drauf. Wenn ich davon nicht so viel zur Verfügung habe, etwa Strauchschnitt oder Sonstiges, dann nehme ich einfach einen Strohballen. Auf den Strohballen gebe ich Kompost und Erde – so erhalte ich ein großes Schichtensystem. Der Vorteil: Das organische Material setzt sich um. Das heißt, ich habe Dünger von unten und "warme Füße" für mein Gemüse, sodass Tomaten, Paprika und all die mediterranen Pflanzen wunderbar darin gedeihen.Sat, 3 Jun 2023 - 02min - 5499 - Sollte man Grasschnitt in den Kompost geben?
Vorsicht Fäulnis: Grasschnitt mit gröberem Material mischen
Gras ist sehr gut für den Kompost, aber es sollte durchmischt werden. Denn wenn man einen zu großen Haufen Gras auf einmal auf den Kompost wirft, beginnt das Gras zu faulen. Der Prozess entsteht durch die Wärme. Lassen Sie das Gras also liegen, sodass es antrocknet. Dann geben Sie Holzstückchen dazwischen oder was sonst so anfällt im Garten. Zum Beispiel kleine Zweige, wenn Sie nach der Ernte die Johannisbeeren zurückschneiden. Oder kleine Äste vom Kirschbaum. Legen Sie das dazwischen, Heu und Gras obendrauf.Joghurt als Kompostbeschleuniger
Wenn man das Kompostieren etwas beschleunigen möchte, kann man einen einfach Trick anwenden, nämlich ein Schälchen Joghurt untermischen. Der Joghurt enthält viele Milchsäurebakterien, die die Kompostierung in Gang setzen. So entsteht keine Fäulnis, sondern Humifizierung. Und Sie kriegen einen super Kompost.Keine Angst vor Samen im Kompost
Wegen der Samen müssen Sie sich keine Gedanken machen. In einem Kompost herrschen circa 80 °C, und bei 80 Grad vergeht alles, was an Samen da ist. So werden Sie auch die Samen los, die Sie nicht haben möchten.Sat, 22 Jul 2023 - 02min - 5497 - Wie kann man sich zu erledigende Dinge besser merken?
Unser Gehirn kann nur eine begrenzte Anzahl von Variablen handhaben. Das heißt, in unserer Aufmerksamkeit können wir nur an eine bestimmte Anzahl von Dingen denken, meist sind das sechs bis sieben. Wenn das angefüllt ist mit Dingen, die notwendig sind, um den eigenen Alltag oder den Familienalltag zu organisieren ist es schwierig, in einem konkreten Moment noch zusätzlich Dinge abzuspeichern. Oder Dinge sind abgespeichert, aber wir können sie in einem konkreten Moment nicht abrufen, weil auch hier die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet ist.
Im Arbeitsgedächtnis sind die aktuell wichtigen Informationen
Wir haben in unserem Stirnlappen ein Gehirnareal, das das Arbeitsgedächnis beinhaltet. Das kann wie eine Art Scheinwerfer ein bisschen ins Gehirn "leuchten": Was ist denn wohl wichtig? – Dort werden alle Aufgaben reingefüllt, die wir aktuell erledigen müssen. Dieser Scheinwefer kann auch nach außen gerichtet sein um darauf zu reagieren, ob in der Umwelt etwas Wichtiges passiert."Gnade des Vergessens", um handlungsfähig zu bleiben
Wenn hier die volle Kapazität ausgeschöpft ist, ist es schwierig, noch weitere Dinge abzuspeichern bzw. abzurufen. Da hilft nur, sich Notizen zu machen oder in bestimmten Momenten in der Organisation innezuhalten und bewusst die Dinge zu durchdenken, achtsam stehen zu bleiben, die Augen zu schließen. Dadurch kann man die Welt kurz ausblenden. Indem man eine kognitive Extraschleife einlegt und die Sache noch einmal durchdenkt, kriegt sie ein Markierung im Gehirn, die die Chance des Erinnerns zumindest deutlich erhöht. Man sollte das aber nicht zu häufig machen. Denn es liegt auch eine gewisse Gnade im Vergessen, damit wir in der nächsten Situation handlungsfähig bleiben.Tue, 30 May 2023 - 01min - 5496 - Was tun in Höhenlagen gegen zu kleine Früchte beim Kürbis?
Kürzere Vegetationszeit in Höhenlagen: Zahl der Kürbisblüten reduzieren
In so hohen Lagen sollte man nur 3 Blüten an der Pflanze lassen. Nach der dritten Blüte knipsen Sie die Pflanze ab. Dann haben die Kürbispflanzen genug Kraft, schöne Kürbisse auszubilden. Sie schauen also, wo die Kügelchen sitzen und nach der dritten oder vierten befruchteten Blüte knipsen Sie ab. Diese Kürbisse reifen aus. Weil Sie in der Höhenlage eine kurze Vegetationszeit haben, können Sie nicht so viele Ansätze gebrauchen.Tue, 30 May 2023 - 01min - 5495 - Warum denkt man im Alter öfter an Ereignisse von früher?
Die Fähigkeit, aktuelle Geschehnisse abzuspeichern, wird im Alter schlechter. Daher hat in der Beurteilung von Situationen das, was wir schon mal erlebt und gelernt haben, ein stärkeres Gewicht. Wir haben eine rechte und eine linke Großhirnhemisphäre. Während die rechte Großhirnhemisphäre vor allem etwas mit Neugierde zu tun hat und damit, Neues zu wagen, macht die linke Großhirnhemisphäre eine Musteranalyse anhand dessen, was wir schon alles gelernt haben. Dort stecken also verstärkt diese Langzeiterinnerungen.
Rechte Großhirnhemisphäre altert schneller
Wenn wir älter werden, altert die rechte Großhirnhemisphäre etwas schneller als die linke, sodass wir etwas weniger neugierig werden und wir uns stärker darauf verlassen, eine neue Situation dadurch zu beurteilen, was wir schon einmal erlebt haben, sodass es uns so vorkommt, als wenn diese älteren Erinnerungen uns eher ins Gedächtnis kommen, unsere Erinnerung daran quasi besser wird. Der Suchfilter unseres Gehirns geht eben dahin, eine neue Situation anhand von dem zu beurteilen, was man schon erlebt hat.Erfahrung als wichtiger gesellschaftlicher Beitrag
Das ist eine ganz wichtige Funktion, die ältere Menschen in unserer Gesellschaft haben: All das, was für viele Menschen neu oder schon Gewohnheit ist, mit Erfahrung zu beurteilen aufgrund dessen, was man in seinem Leben schon erlebt hat.Tue, 11 Jul 2023 - 01min - 5494 - Schädigt Alkohol das Gedächtnis?
Alkoholpegel über mehrere Promille: Nervenzellen können absterben
Es gilt wie so oft: Die Menge macht das Gift. Früher sagte man, dass ein Glas Bier 400 Nervenzellen kostet – das ist Quatsch. Dennoch: Wenn man in einem bestimmten Zeitsegment, sagen wir drei oder vier Stunden, viel Alkohol trinkt und der Alkoholpegel mehrere Promille beträgt, kann man tatsächlich Nervenzellen schädigen – bis hin zum Absterben von Nervenzellen. Man muss wissen: In 99 Prozent aller Gehirnareale können diese Nervenzellen nicht mehr ersetzt werden; die sind also unwiederbringlich verloren. Nur im Riechhirn und in einem für das Gedächtnis wichtigen Gehirnareal, dem Hippocampus. können noch neue Nervenzellen zur Regeneration gebildet werden. Insofern ist es ratsam, mit dem Alkohol sehr rationiert umzugehen.Geringe Mengen Alkohol können für bessere Durchblutung im Gehirn sorgen
Es gibt allerdings auch Studien, die zeigen, dass geringe Mengen Alkohol – jeden Tag 0,1 Liter Wein oder andere Alkoholika oder jeden zweiten Tag 0,2 Liter eines nicht zu hochprozentigen alkoholischen Getränks – sogar förderlich für das Gehirn sein können. Denn in der besseren Durchblutung des Gehirns kann man einen Vorteil sehen. Wenn man gar keinen Alkohol trinkt hat man demnach sogar ein ganz leicht erhöhtes Risiko, an Alzheimer zu erkranken.Alkohol in geringen Mengen: keine negative Wirkung aufs Gehirn
Wer nun denkt, er könnte jeden Tag zwei Flaschen Wein trinken, täuscht sich, denn damit geht das Risiko wieder in die andere Richtung. Aber geringe Alkoholmengen, gut verteilt über die Woche oder den Monat, haben keine nachweislich negative Wirkung auf das Gehirn.Fri, 26 May 2023 - 02min - 5493 - Warum vertragen sich manche Pflanzen nicht miteinander?
Phlox: Konkurrenz unter Geschwistern
Wenn man zum Beispiel zwei oder drei schöne Phlox nebeneinander pflanzt, weil sie farblich gut zueinander passen – blau, rosa, weiß – kann es passieren, dass zwei nicht mehr wollen und nur einer übrig bleibt. Der ist der Dominante und drückt die anderen weg.Holunder verdrängt den Sonnenhut
Holunder verträgt sich auch nicht mit jedem. Holunder sind zwar wunderschön, besonders die rotblättrigen, die aussehen wie Ahorn und der Holunder ist eine wunderbare Begleitpflanze. Aber man darf sie nicht neben Echinacea pflanzen, also neben den Sonnenhut. Der Holunder würde den Sonnenhut komplett verdrängen. Man muss also auf die Pflanzengemeinschaften achten. Manchmal riecht eine Pflanze sehr stark und wird daher nicht vertragen, und manchmal mögen sich Geschwister nicht. Wenn man darauf achtet, hat man einen schöneren Garten.Wed, 28 Jun 2023 - 00min - 5492 - Wie bekommt man die Ackerwinde aus dem Garten?
Ackerwinde durch Stinkenden Storchschnabel vertreiben
Gegen die Ackerwinde kann man im Ökogarten eigentlich nichts machen. Was vielleicht hilft ist, Stinkenden Storchschnabel daneben zu pflanzen, denn der vertreibt die Ackerwinde. Der Stinkende Storchschnabel ist eine Konkurrenzpflanze. Es ist das kleine Gewächs, das überall an Wegrändern und Mauern wächst. Den Storchschnabel können Sie kleinhacken und drüberstreuen oder Sie können ihn dazu pflanzen. Eine 100-Prozent-Garantie gibt es leider nicht; der Erfolg ist eine Frage der Dynamik. Fühlt sich die Ackerwinde so richtig wohl, hat beste Voraussetzungen und besten Boden – dann wird es schwierig. Einen Versuch ist es aber wert.Wed, 5 Jul 2023 - 01min - 5491 - Was ist ein ökologischer Garten?
Keine Pestizide, kein Torf – und gerne wilde Ecken
In einem ökologischen Garten versucht man, das Gleichgewicht so hinzubekommen, dass alles Leben im Garten gedeihen kann. Man verzichtet auf jegliche Art von Pestiziden, mineralische Dünger und Torf. Und man versucht, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Schädlingen und Nützlingen. Man greift in den ökologischen Garten immer nur dann ein, wenn es notwendig ist. Nicht, weil man denkt, dass man einen "sauberen" Garten haben muss. Natur ist schön, aber nicht sauber. Ein schöner Garten kann auch mal wilde Ecken haben. Man muss ein bisschen toleranter sein – ein englischer Garten oder ein Rabattenbeet passen nicht zum Naturgarten.Sun, 25 Jun 2023 - 00min - 5490 - Welche Rolle spielt Artenvielfalt im ökologischen Garten?
Wir haben heute ein Problem mit der fehlenden Biodiversität. Die Vielfalt geht durch viele Monokulturen verloren, ob nun in der Landwirtschaft, im Garten oder in der Stadt.
Blühender Ökogarten lockt Insekten und Vögel an
Im Ökogarten oder Naturgarten achtet man darauf, dass es zum Beispiel viele Zwiebelblumen gibt, dass es vom Frühling bis zum Herbst und vielleicht sogar bis in den Winter hinein blüht. So haben alle Insekten, also nicht nur unsere Honigbienen, sondern auch die Wildbienen, immer genug Nahrung. Und wenn viele Insekten im Garten sind, gibt es auch viele Vögel im Garten. Nur wenn man einen gedeckten Tisch hat, hat man auch Besucher.Tue, 23 May 2023 - 00min - 5489 - Entfernt die Spülmaschine Krankheitserreger?
Infektionskrankheit: Hygienisch sauber wird Geschirr im Normalprogramm
Die Spülmaschine zu benutzen ist das Beste, was Sie machen können, um zu Hauser des Geschirr sauber zu bekommen. Wenn Sie hygienisch auf Nummer sicher gehen wollen, nehmen Sie das Normalprogramm oder sogar das Programm mit dem Symbol "Topf und zwei Untertassen", also das 75-Grad-Programm. Dann sind Sie absolut auf der sicheren Seite.Energiesparprogramm nutzen, aber gelegentlich Normalprogramm fahren
Die Ökoprogramme, die wir im Augenblick benutzen, um Energie zu sparen, kann man guten Gewissens benutzen, wenn man ab und zu, etwa einmal die Woche, auch das Normalprogramm fährt. Das ist gut für die Hygiene der Maschine und auch die des Geschirrs, das in der Maschine ist.Tue, 21 Mar 2023 - 00min - 5488 - Gibt es eine ideale Geburtsposition?
Aufrechte Haltung ist vorteilhaft
Nein. Entscheidend ist, dass die Schwangere sich gut fühlt. Das kann morgens anders sein als abends. Die Schwangere muss sich bewegen können. Ideal ist es, nicht in der Rückenlage zu sein. In der Eröffungsperiode, also bis sich der Muttermund öffnet, ist eine aufrechte Position gut – laufen, sitzen, zur Entspannung auch in der Badewanne. Wichtig ist, was der Schwangeren gut tut.Fri, 4 Nov 2022 - 00min
Podcasts semelhantes a 1000 Antworten
 Mit den Waffeln einer Frau barba radio, Barbara Schöneberger
Mit den Waffeln einer Frau barba radio, Barbara Schöneberger Der Tag Deutschlandfunk
Der Tag Deutschlandfunk Die Nachrichten Deutschlandfunk
Die Nachrichten Deutschlandfunk Eine Stunde History - Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk Nova
Eine Stunde History - Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk Nova Psychologie to go! Dipl. Psych. Franca Cerutti
Psychologie to go! Dipl. Psych. Franca Cerutti Kriminalhörspiel Hörspiel und Feature
Kriminalhörspiel Hörspiel und Feature Die Ernährungs-Docs - Essen als Medizin NDR
Die Ernährungs-Docs - Essen als Medizin NDR Zwischen Hamburg und Haiti NDR Info
Zwischen Hamburg und Haiti NDR Info Gysi gegen Guttenberg – Der Deutschland Podcast Open Minds Media, Karl-Theodor zu Guttenberg & Gregor Gysi
Gysi gegen Guttenberg – Der Deutschland Podcast Open Minds Media, Karl-Theodor zu Guttenberg & Gregor Gysi "Kein Mucks!" – der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka (Neue Folgen) Radio Bremen
"Kein Mucks!" – der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka (Neue Folgen) Radio Bremen Sinnlos Märchen RADIO PSR
Sinnlos Märchen RADIO PSR Geschichten aus der Geschichte Richard Hemmer und Daniel Meßner
Geschichten aus der Geschichte Richard Hemmer und Daniel Meßner Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft RTL+ / Philipp Fleiter
Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft RTL+ / Philipp Fleiter WDR Zeitzeichen WDR
WDR Zeitzeichen WDR Einschlafen mit Wikipedia Wikipedia & Schønlein Media
Einschlafen mit Wikipedia Wikipedia & Schønlein Media Kurt Krömer - Feelings Wondery
Kurt Krömer - Feelings Wondery Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen ZDF - Aktenzeichen XY
Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen ZDF - Aktenzeichen XY LANZ & PRECHT ZDF, Markus Lanz & Richard David Precht
LANZ & PRECHT ZDF, Markus Lanz & Richard David Precht Verbrechen ZEIT ONLINE
Verbrechen ZEIT ONLINE
Outros Podcasts de Ciência e Medicina
 Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen WELT
Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen WELT radioWissen Bayerischer Rundfunk
radioWissen Bayerischer Rundfunk Das Wissen | SWR SWR
Das Wissen | SWR SWR Forschung aktuell Deutschlandfunk
Forschung aktuell Deutschlandfunk IQ - Wissenschaft und Forschung Bayerischer Rundfunk
IQ - Wissenschaft und Forschung Bayerischer Rundfunk ZEIT WISSEN. Woher weißt Du das? ZEIT ONLINE
ZEIT WISSEN. Woher weißt Du das? ZEIT ONLINE Sternengeschichten Florian Freistetter
Sternengeschichten Florian Freistetter So bin ich eben! Stefanie Stahls Psychologie-Podcast für alle "Normalgestörten" RTL+ / Stefanie Stahl / Lukas Klaschinski
So bin ich eben! Stefanie Stahls Psychologie-Podcast für alle "Normalgestörten" RTL+ / Stefanie Stahl / Lukas Klaschinski Forschung aktuell Deutschlandfunk
Forschung aktuell Deutschlandfunk stern Crime - Spurensuche RTL+ / Stern.de GmbH / Audio Alliance
stern Crime - Spurensuche RTL+ / Stern.de GmbH / Audio Alliance WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr WDR 5
WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr WDR 5 SPIEGEL Geschichte DER SPIEGEL
SPIEGEL Geschichte DER SPIEGEL Betreutes Fühlen Atze Schröder & Leon Windscheid
Betreutes Fühlen Atze Schröder & Leon Windscheid Sternzeit Deutschlandfunk
Sternzeit Deutschlandfunk Rätsel der Wissenschaft DER STANDARD
Rätsel der Wissenschaft DER STANDARD الأعمال الكاملة لـ د. مصطفى محمود Podcast Record
الأعمال الكاملة لـ د. مصطفى محمود Podcast Record Spektrum-Podcast detektor.fm – Das Podcast-Radio
Spektrum-Podcast detektor.fm – Das Podcast-Radio His2Go - Geschichte Podcast David Jokerst & Victor Söll
His2Go - Geschichte Podcast David Jokerst & Victor Söll Schneller schlau - Der kurze Wissenspodcast von P.M. RTL+ / P.M. / Audio Alliance
Schneller schlau - Der kurze Wissenspodcast von P.M. RTL+ / P.M. / Audio Alliance c’t uplink - der IT-Podcast aus Nerdistan c’t Magazin
c’t uplink - der IT-Podcast aus Nerdistan c’t Magazin